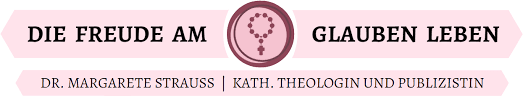Jes 40,1-5.9-11; Ps 85,9-10.11-12.13-14; 2 Petr 3,8-14; Mk 1,1-8
Jes 40
1 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.
2 Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden!
3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!
4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.
5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen.
9 Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott.
10 Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her.
11 Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.
Der heutige Jesajatext kündigt die babylonische Gefangenschaft an, mit der eine große Bedrängnis für die Juden kommen wird. Ihr Tempel wird ihnen weggenommen werden und sie werden Gott nicht mehr opfern können. Wenn es heißt: „Redet zum Herzen Jerusalems“, dann meint es wohl zu den Herzen der Menschen, ihnen ins Gewissen zu reden. Denn das, was genannt wird, betrifft ihr Verhalten: Jesaja deutet Jerusalems Zustand als Folge ihrer Sünde. Die Sühne ist mit dem Abschluss des Exils jedoch abgeschlossen, sodass sie dafür doppelt so viel erhalten. Ihr Frondienst ist zuende. Diese Übersetzung ist nicht die Primäre, aber passt sehr gut für den Literalsinn in diesem Kontext: Die Juden sind von den Babyloniern gefangen genommen worden und mussten ihnen gewiss dienen. Jesaja kündigt in dem Kapitel zuvor König Hiskija an, dass dessen Söhne als Eunuchen im babylonischen Palast dienen würden. Das hebräische Wort צְבָאָ֔הּ zwa’ah bedeutet primär „Drangsal, Not“. Das griechische AT sagt an der Stelle tapeinosis, in der Offb wird stattdessen tlipsis geschrieben. Es umschreibt eine Bedrängnis, die mit dem leidvollen Dasein dieser Welt zu tun hat. Es ist ein eschatologischer Begriff und deshalb eschatologisch auszulegen. Die Zeit der Bedrängnis ist auch allegorisch gelesen vorbei, denn bald kommt der Messias. Das perspektivlose Volk hat wieder Grund zur Hoffnung. Heilsgeschichtlich gesehen kommt mit dem Messias die Wende. Vom Sündenfall bis zu Gottes Menschwerdung war der Himmel verschlossen. Kein Mensch hatte Zugang. Dies ändert sich mit der messianischen Heilszeit. Jesus ist gekommen und hat uns erlöst. Durch die Kirche bringt er auch heute noch Hoffnung in eine Zeit der Perspektivlosigkeit und Verzweiflung. Der Frondienst der Sünde hat ein Ende, wo die Menschen Jesus als Herrn und Erlöser akzeptieren und umkehren. Dies zeigen sie durch die Sakramente, in denen sie sich taufen lassen und ein christliches Leben mit regelmäßiger Beichte und Eucharistie führen. So werden sie immer wieder von der Bedrängnis befreit. Das Wort zwa’ah kann auch mit Kampf, Heer, Kriegsdienst übersetzt werden. Die Menschen stehen untereinander und in sich selbst im Zwiespalt. Von diesem werden sie durch Christus befreit. Wir bekommen inneren Frieden und können von dort aus auch mit anderen Menschen in Frieden leben. Wir kämpfen auch nicht mehr gegen Gott durch die Sünde, sondern versöhnen uns mit ihm in der Beichte. Schließlich ist die Zeit des Kampfes am Ende der Zeiten ganz vorbei, wenn Jesus wiederkommt. Dann werden wir nicht mehr die streitende Kirche, sondern die triumphierende oder leidende Kirche sein (mit Aussicht auf die triumphierende Kirche). Diese endgültige Befreiung der gesamten Weltgeschichte vom Bösen am Ende der Zeiten sowie das Kommen des Messias als Mensch werden durch eine Stimme angekündigt, die in der Wüste ruft. Dieser ist ein Ruf zur Umkehr und Vorbereitung auf den Messias. Nach dem Literalsinn könnte man meinen, dass es sich auf Jesaja und die Propheten nach ihm bezieht. Das Rufen aus der Wüste bezieht sich dann auf die judäische Wüste, die später dann auch zum Schauplatz des Täufers wird. Dieser ist dann typologisch auf Jesaja zu beziehen. Er ruft nämlich gerade zu Umkehr und Vorbereitung auf den Messias. Ekklesiologisch weitergedacht wird die Kirche immer wieder zur Stimme, die in der Wüste die Menschen ruft, damit sie an die Quelle lebendigen Wassers kommen, die eine Oase mitten in der Dürre der Wüste sind. Hier handelt es sich um geistige Dimensionen. Schauen wir auf unsere Welt, die seelisch vertrocknet. Die Kirche ruft die Menschen konkret zu den Sakramenten, insbesondere der Beichte als Umkehr und der Eucharistie als Begegnung mit dem fleischgewordenen Wort Gottes. Gott ruft jeden Menschen durch die eigene innere Stimme des Gewissens zu sich, sodass er umkehrt und wieder in den Stand der Gnade kommt.
Wenn es dann heißt „die Welt wird ihn sehen“, meint es zunächst den Messias, der Mensch geworden ist und unter den Menschen gelebt hat. Es mein aber auch sakramental das Sehen in der Eucharistie. Die Welt sieht ihn auch im liebenden Mitmenschen, im Nächsten. Diese moralische Perspektive hat er ihnen selbst durch seine Rede eröffnet, die er mit den Worten beschließt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan (Mt 25).“ Schließlich meint es am Ende der Zeiten das Kommen des verherrlichten Menschensohns. Es heißt bei der Ankündigung, dass jedes Auge ihn sehen werde (Offb 1). Interessant ist der Nachsatz: Denn der Mund des Herrn hat geredet. Das Wort, das Gott spricht, ist ja der Sohn, der Mensch geworden ist. Das bezieht sich wiederum auf Christus. Durch die Vergleiche mit der vergehenden Schöpfung wird dieses Wort Gottes als ewig gekennzeichnet, wodurch Jesu Existenz als ewig mitgesagt wird. Jesus selbst sagt an einer Stelle dann: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Wort werden nicht vergehen (Mt 24).“
Weiter heißt es, dass der Messias mit Kraft kommt und sein Arm seine Herrschaft ausübt. Das ist nicht nur wörtlich zu verstehen im Sinne einer politischen Befreiungsaktion. Sonst könnte man auch an Kyros denken, der das Volk ja kurzzeitig befreit und den Bau eines neuen Tempels ermöglicht. Es muss sich um eine umfassende Befreiung handeln und bezieht sich deshalb auf einen Messias mit übermenschlicher, eschatologischer Macht. Er wird nicht innerpolitisch (im Sinne von „innerhalb der Welt“) herrschen. Er wird auch nicht mit Gewalt herrschen, wie wir es von weltlichen Regenten gewohnt sind, sondern mit einer Liebeskraft, die in der Ohnmacht und Schwachheit zutage tritt. Dass wir solch einen Messias erwarten und eben nicht so einen Kyros, zeigt sich an der Aussage, dass er wie ein Hirte sein und weiden wird. Dies wird sich mit Jesus erfüllen, der selbst sagen wird: „Ich bin der gute Hirte (Joh 10).“ In seiner Nachfolge wird er Petrus dazu aufrufen, wie ein Hirte zu sein: „Weide meine Lämmer (Joh 21).“
Ps 85
9 Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet der HERR seinem Volk und seinen Frommen, sie sollen sich nicht zur Torheit wenden.
10 Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.
11 Es begegnen einander Huld und Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
12 Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.
13 Ja, der HERR gibt Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag.
14 Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte.
Als Antwort beten wir Psalm 85, der für die jüdische Liturgie bestimmt war. Es geht in diesen Versen um die Bitte um Gerechtigkeit. Wir sehen das leidende Volk Israel vor uns, das um Erlösung vom „Frondienst“ bittet.
„Ich will hören, was Gott redet“ ist ein Ausdruck der Bereitschaft des Beters. Gottes Willen anzuhören und nicht verstockt zu sein, ist eine wichtige Zusage an Gott. Es ist ein: „Rede HERR, dein Diener hört“ in Psalmensprache. Die Selbstaufforderung ist als Psalmenanfang ja häufig belegt. Gott verkündet seinem Volk den Frieden, das ist so eine große Verheißung, dass ihre Ablehnung eine einzige Torheit darstellt, einen absoluten Leichtsinn. Wer einen gesunden Menschenverstand besitzt, kann nur so reagieren. Wie kann man einen großen Schatz links liegen lassen und stattdessen im Kuhfladen herumstochern? Dieser Friede, der Schalom, ist Gottes Gabe, die hier noch als Gabe an das auserwählte Volk Israel verstanden wird. Bei Paulus weitet sich aber der Blick auf alle Menschen, die den Frieden Gottes in ihren Herzen willkommen heißen.
Im Folgenden hören wir von Heilsverheißungen: Huld und Treue begegnen einander. Das Begriffspaar wird üblicherweise auf Gott bezogen. Sie sind seine Eigenschaften. Ebenso kommen „Gerechtigkeit und Friede“ von Gott. Wenn hier bildlich-poetisch gesagt wird, dass sie sich küssen, meint das ihre Verbindung. Ich habe schon öfter erklärt, dass dem umfassenden Heil eine Gerichtsvollstreckung vorausgeht. Beides gehört zusammen. Gericht und Heil sind zwei Seiten einer Medaille. Der Friede des Gottesreiches kommt, nachdem alles Böse vernichtet und gerichtet worden ist. Es hat im Reich Gottes keinen Platz. Gottes Gerechtigkeit ist nicht als etwas Böses und Angsterfüllendes anzusehen, sondern als Erlösung von den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Bedrohlich ist es nur für jene, die bis zum Schluss Gott abgelehnt haben. Diese erhalten dann ihre finale Abrechnung.
„Treue sprosst aus der Erde hervor“ ist eine wunderbare poetische Formulierung, die verdeutlicht: Egal, wie sehr nun alles in Trümmern liegt und zerstört ist – Gott ist dennoch treu und hält fest an dem Bund, den er mit seiner Braut geschlossen hat. Die Treue sprosst aus der Erde hervor, denn die Wurzeln sind trotz der Verwüstung intakt geblieben. Auch wenn die Bäume abgehauen worden sind (was ein Gerichtsbild ist, das auch Johannes der Täufer aufgreifen wird), wächst aufgrund der gebliebenen Wurzel ein neuer Baum hervor. Und die hervorsprossende Treue in Person ist Jesus Christus, auf dessen Geburt wir zugehen.
„Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder“ ist wie bereits oben beschrieben keine bedrohliche Aussage, sondern ein tröstlicher Satz. Gott ist der Zustand auf Erden nicht egal. Er kümmert sich um seine Schöpfung und greift ein, wo Ungerechtigkeit herrscht. Er blickt vom Himmel herab, der sein „Wohnort“ ist, das heißt trotz seiner Existenz in der Ewigkeit sieht er alles, was im Diesseits geschieht. Das ist eine Aussage gegen deistische Konzepte.
Was von Gott kommt, ist immer gut. Auch das Gericht ist etwas Gutes, weil ohne es das umfassende Heil nicht kommen kann. Er gibt Gutes auch schon im Diesseits, indem er zum Beispiel für eine gute Ernte sorgt. Das ist Ausdruck seines Segens für die Menschen.
„Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte.“ Wie mehrfach gesagt kann Gott erst unter den Menschen wohnen im Himmlischen Jerusalem, wenn seine Gerechtigkeit alles Böse vernichtet, die gefallene Schöpfung komplett auf Null gebracht und eine neue Schöpfung hervorgebracht hat. Weil Gott der Gute ist, kann nichts Böses in seiner Gegenwart bestehen.
Für uns bedeutet diese Aussage ganz konkret: Der ganze Zustand in unserer Welt muss erst immer schlimmer werden, weil es wie die Geburtswehen ist, die dem Glück des geborenen Kindes vorausgehen. Diese werden auch immer stärker, bis das Kind endlich kommt. Es ist für uns in dieser Welt also sehr schmerzhaft und wird immer schlimmer, aber wir wissen, dass mit zunehmender Drastik das Kommen unseres Herrn immer näherrückt. Und sein Erbe, der Hl. Geist, trägt uns in diesen letzten Tagen hindurch.
2 Petr 3
8 Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind.
9 Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen.
10 Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden.
11 Wenn sich das alles in dieser Weise auflöst: Wie heilig und fromm müsst ihr dann leben,
12 die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen! An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen.
13 Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.
14 Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu werden!
In der zweiten Lesung hören wir heute eine Lesung aus dem zweiten Petrusbrief. Dort geht es um die Wiederkunft Christi, um den zweiten Advent also. Schon letzte Woche haben wir eine Mischung aus adventlichen Texten bezüglich des ersten und des zweiten Kommens Christi gehört. Petrus schreibt hier zu Anfang einen wichtigen Grundsatz: Bei Gott herrschen andere Kategorien. Unser Zeitablauf ist anders als in der Ewigkeit. Da gibt es im Grunde gar keine Zeit. Zeit ist ein geschaffenes Element, von dem uns in der Genesis berichtet wird. In der biblischen Zahlenmetaphorik bedeutet die Zahl Tausend eine lange Zeit. So ist es ein „Tag“ beim Herrn (wenn man das überhaupt so sagen kann, wir können nur in uns bekannten Kategorien denken und sprechen) eine ganz lange Zeit im Diesseits ist. Und umgekehrt ist eine Ewigkeit in Gottes Reich nur ein Tag im Diesseits. Es gibt also bei Gott ein eigenes Timing und wir können deshalb als Wartende in der Endzeit nicht sagen: Warum lässt Gott sich denn so viel Zeit? Warum zögert er, das Ende der Zeiten einzuleiten?
Gott zögert nicht, sondern wir durchblicken seinen Heilsplan nicht in seiner gesamten Reichweite. Alles hat seinen Sinn und so ist die vermeintliche Verzögerung Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, der den Christen in der Endzeit noch so lange wie möglich die Chance zur Umkehr ermöglichen möchte. Er möchte möglichst alle Menschen retten, deshalb kommt das Ende der Zeiten noch nicht.
Wann das Ende der Zeiten aber wirklich kommt, ist unbekannt. Es ist wie mit einem Dieb, der unangekündigt ins Haus eindringt. Dieses Bild verwendet ja auch Jesus selbst, um das unbekannte Weltende zu umschreiben.
Wenn es dann soweit ist, kommt es zu einem apokalyptischen Chaos, das in seinen drastischen Einzelheiten in der Johannesoffenbarung beschrieben wird. Die Schöpfung wird auf Null gesetzt, alles bricht ab, nur um neu errichtet zu werden.
Die vorausgehenden Wehen werden den Christen aber eindeutige Zeichen sein, wodurch sie sich bereit machen sollen: „Wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen!“
Alles wird in Feuer aufgehen, aber warum? Weil Gottes verzehrendes Feuer, das die Liebe ist, sich der Schöpfung nähert. Da kann nichts bestehen und muss in Flammen aufgehen! Was dann aber übrigbleibt, ist pures Gold, das in der neuen Schöpfung leben kann, die Heiligen Gottes!
Deshalb erfolgt am Ende der Lesung der Aufruf zu einem heiligmäßigen Leben und zur aufrichtigen Umkehr. Christen müssen sich bemühen, ohne Fehl und Makel zu sein.
Mk 1
1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.
2 Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja – Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird.
3 Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! – ,
4 so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden.
5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
7 Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Im heutigen Evangelium wird der letzte und zugleich bedeutendste Prophet eingeführt, der den Messias ankündigt – Johannes der Täufer. Sein ganzes Dasein besteht in der Buße und Bußpredigt. Er ist heilsgeschichtlich von sehr großer Bedeutung, sodass die Erfüllung des in der ersten Lesung gehörten Schriftwortes hier zum Tragen kommt (Jes 40,3). Johannes‘ Botschaft lautet: Wer zum „heiligen Berg“ der heutigen Jesajalesung gehören will, muss Buße tun. So verwendet er die Bilder, die Jesaja in der Lesung bereits angewandt hat: Bereitet dem Herrn den Weg. Das ist eine absolut ethische Aussage, denn die Wegmetapher wird in der biblischen Tradition stets auf das ethische Verhalten des Menschen bezogen. Denn es heißt ja in Jesaja, dass man bei Gott nichts Böses tun wird. Und der zweite Petrusbrief hat uns ja vermittelt, dass nur Heiliges das Feuer der Liebe Gottes aushalten wird. Es besteht noch die Chance, umzukehren, aber es ist kurz vor 12. Johannes schildert dies durch ganz drastische Bilder wie der Axt, die an den Baum angelegt ist, oder der Schaufel in der Hand. Warum verwendet er ausgerechnet so ein Bild? Dafür müssen wir noch einmal bei Jesaja schauen: In Jes 10 heißt es unter anderem: „Prahlt denn die Axt gegenüber dem, der mit ihr hackt…“ (15) und einige Verse weiter dann: „und die Herrlichkeit seines Waldes und seines Baumgartens vernichtet er…“ (18) Schließlich heißt es: „Siehe, Gott, der HERR der Heerscharen, schlägt mit schrecklicher Gewalt die Zweige ab. Die Hochgewachsenen werden gefällt und die Emporragenden sinken nieder. Er rodet das Dickicht des Waldes mit dem Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen.“ (33-34). Es handelt sich um dieselbe Metaphorik, die Johannes aufgreift und an die Jes 11 mit dem Baumstumpf anschließt! Gott muss zuerst etwas platt machen, bevor etwas Neues entstehen kann. Diese Anspielung von Jesaja wird den Menschen bekannt gewesen sein. Sie werden den messianischen Code begriffen haben. In seiner Verkündigung verdeutlicht Johannes ja auch, dass derjenige, den er ankündigt, viel größer ist als er (nicht mal die Sandalen zu lösen ist er würdig).
Sowohl Petrus als auch Johannes der Täufer bereiten die Menschen auf das Kommen des Messias vor – der eine auf das erste Kommen bei der Menschwerdung Christi, der andere auf das zweite Kommen am Ende der Zeiten als verherrlichten Menschensohn. Es ist eine Zeit des Tuns – nämlich der tätigen Liebe. Nehmen wir auch heute einander an und ertragen einander in Liebe, denn der Herr kommt bald. Tun wir dies auf längere Sicht, tun wir dies aber auch ganz besonders jetzt in der Zeit des Advents. Wie auch in der Fastenzeit ist dies jetzt eine Zeit der Gnade, in der wir vermehrt Liebesdienste erweisen und unsere Beziehung zu Gott vertiefen können. Erkennen wir die Zeit der Gnade!
Ihre Magstrauss