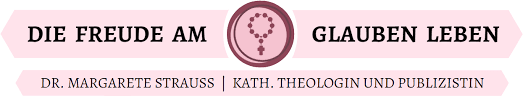Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,1-2.3.5-6.15 u. 17; 1 Kor 12,31 – 13,13; Lk 4,21-30
Jer 1
4 Das Wort des HERRN erging an mich:
5 Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt.
17 Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage! Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken!
18 Siehe, ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur bronzenen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamten und Priester von Juda und gegen die Bürger des Landes.
19 Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen; denn ich bin mit dir, um dich zu retten – Spruch des HERRN.
Als erste Lesung hören wir heute die Berufung des Propheten Jeremia. Es handelt sich dabei um einen manchmal pessimistisch wirkenden Menschen, der viele Selbstzweifel hat. Vielleicht muss man statt Pessimismus eher Realismus sagen. Jedenfalls lebt Jeremia in der Zeit unmittelbar vor dem Babylonischen Exil im Südreich Juda. Er wird vor der Katastrophe des Exils warnen, doch die Menschen werden sich nicht bekehren. Sie werden in die Verbannung geschickt, Jeremia selbst bleibt auf den Trümmerhaufen Jerusalems zurück mit den wenigen, die zurückgeblieben sind. Später wird er gezwungen, mit ihnen nach Ägypten zu fliehen. Uns erinnert der gehörte Text an Johannes den Täufer. Nicht umsonst wird ein Teil dieser Lesung auch am Geburtsfest Johannes‘ des Täufers verlesen. Beide, sowohl Jeremia als auch Johannes der Täufer, hat Gott bereits „ausersehen“, bevor sie geboren werden. Bereits im Mutterleib sind sie beide geheiligt worden, das heißt vom Rest unterschieden. Das ist vergleichbar mit dem priesterlichen Stamm Levi, der von den anderen Völkern abgegrenzt und geheiligt worden ist.
Wie gesagt ist Jeremia eher Realist. So schaut er auf seinen gegenwärtigen Zustand und entgegnet Gott, dass er noch zu jung und nicht fähig zu einer guten Artikulation sei. Dahinter steht die Einstellung, dass er für eine Berufung zunächst eine gewisse Kompetenz aufweisen müsse. Doch Gott lehnt so eine Haltung ab. Er beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Deshalb betont er die Berufung: „Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden.“ Gleichzeitig ermutigt er Jeremia, dass er keine Angst haben muss. Gott selbst wird mit ihm sein, um ihn zu retten.
Gott „berührt“ Jeremias Mund mit seiner „Hand“. Das ist bildhaft gemeint, denn Gott kann als reiner Geist keine Hand haben. Und doch hat ihn ja etwas oder jemand berührt. Entweder ergehen die Worte Gottes durch einen Engel – doch auch diese sind Geistwesen. Engel als Boten Gottes überbringen dessen Botschaft. Dazu würde auch das „Spruch des HERRN“ passen. Oder Jeremia fühlt sich auf eine Weise am Mund berührt.
Seine Berufung besteht darin, inmitten von Völkern und Reichen aufzutreten. Dabei soll er „ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen.“ Diese Gartenmotivik ist sehr passend, um die beiden Seiten seiner Verkündigung zu verdeutlichen: Einerseits soll er Gerichtspredigt halten, wozu die ersten vier Begriffe passen. Andererseits soll er Hoffnung spenden und das Heil Gottes ankündigen.
In diesen beiden Aspekten des prophetischen Wirkens sind wir ganz bei Johannes dem Täufer. Er hat eine raue Gerichtspredigt vollzogen, in der er mit drastischen Bildern und Bezeichnungen die Menschen aufgerüttelt hat – bis hin zur Schlangenbrut. Zugleich hat er auf das Heil Jesu Christi verwiesen, dessen er nicht einmal würdig war, die Riemen der Sandalen zu lösen.
Die Analogie setzt sich fort, wenn wir den Appell lesen, dass sich Jeremia gürten und furchtlos vor den Menschen auftreten solle. Gegürtet mit einem Ledergürtel tritt auch der Täufer auf. Die Geste des Gürtens hat mehrere Bedeutungen: Gegürtet hat man sich zur Reise oder zum Kampf. Beides passt gewissermaßen auf ihn, denn Jeremia macht sich auf den Weg (zunächst im übertragenen Sinne bei seinem öffentlichen Auftreten, dann im wörtlichen Sinne, wenn man ihn wider Willen nach Ägypten bringt). Er rüstet sich aber auch aus zum Kampf, den er immer wieder verliert – die Menschen hören nicht auf seine Warnungen. Es ist eine einzige geistliche Schlacht, die er gegen das Gottesvolk führt, das Gottes Stimme ignoriert und am Bösen festhält. Jeremia ist Gottes Feldherr, deshalb muss er sich nicht fürchten. Er kämpft schließlich auf der Seite der Gewinner. Dafür rüstet Gott ihn aus, bevollmächtigt ihn für seinen Dienst. Es wird umschrieben mit militärischen Begriffen: Eine befestigte Stadt ist eine mit Mauern und Festungen umgebene Stadt, die Feinde abwehren kann. Säulen und Mauern sind für die Verteidigung notwendig, im Falle Jeremias sind sie sogar aus besonders widerspenstigem Material. Gottes Schutz und Verteidigung ist besser als jegliche menschliche. Keiner kann Jeremia etwas antun. Dafür werden die Mächtigen des Gottesvolkes, die Einflussreichen und elitären Menschen aufgezählt. Niemand von ihnen kann Jeremia etwas antun, wenn Gott auf seiner Seite ist. Und all diese werden zu Gegnern Gottes und seines Werkzeugs Jeremia, wenn sie sich gegen Gottes Willen sträuben. Und doch werden sie nichts ausrichten, weil Gott ihm beisteht. Welch ein Trost, bei dem wir alle uns angesprochen fühlen dürfen! Gott ist bei uns, Jahwe, um uns zu retten – Jesus, Jahwe rettet! Nicht umsonst schreibt Paulus in seinen Briefen: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Dieser ist treu und steht zu seinem Wort, immer bei uns zu sein bis zum Ende der Welt.
Ps 71
1 Bei dir, o HERR, habe ich mich geborgen, lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit!
2 Reiß mich heraus und rette mich in deiner Gerechtigkeit! Neige dein Ohr mir zu und hilf mir!
3 Sei mir ein schützender Fels, zu dem ich allzeit kommen darf! Du hast geboten, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Festung.
5 Denn du bist meine Hoffnung, Herr und GOTT, meine Zuversicht von Jugend auf.
6 Vom Mutterleib an habe ich mich auf dich gestützt, aus dem Schoß meiner Mutter hast du mich entbunden, dir gilt mein Lobpreis allezeit.
7 Für viele wurde ich wie ein Gezeichneter, du aber bist meine starke Zuflucht.
8 Mein Mund ist erfüllt von deinem Lobpreis, den ganzen Tag von deinem Glanz.
15 Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden, den ganzen Tag von deinen rettenden Taten, denn ich kann sie nicht zählen.
17 Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis heute verkünde ich deine Wunder.
Als Antwort auf die Berufung des Jeremia beten wir den Bittpsalm 71. Er ist durchzogen von Vertrauensaussagen. David als Komponist hat ein besonderes großes Gottvertrauen, das sehr gut als Antwort auf Gottes Zusage in der Lesung passt. „Bei dir, o HERR, habe ich mich geborgen“ kann nicht nur der König sagen, sondern auch Jahrhunderte später Jeremia. Gott war bei seinem ganzen Wirken, das oft sehr schwer war, an seiner Seite. So wie David darum bittet, das Gott ihn auf ewig nicht verlassen möge, so hat es wohl Jeremia immer wieder getan, besonders in Zeiten der Bedrängnis. Auch er musste zu Gott rufen: „Reiß mich heraus und rette mich in deiner Gerechtigkeit!“ Das Anstrengende seines Prophetendienstes bestand darin, dass er sehr oft harte Gerichtsrede vornehmen sollte und damit zum Buhmann Judas geworden ist. Wer setzt sich gerne dem Murren anderer aus, weil man etwas predigt, das ihnen offensichtlich nicht gefällt! Und doch ist er gehorsam und tut, was Gott von ihm verlangt. Und wenn es ihn trifft, dass die Leute im Grunde Gott ablehnen, stützt ihn der Herr. Gott neigt ihm das Ohr, erhört seine Bitten, ist ihm ein schützender Fels, ganz wie er bei seiner Berufung versprochen hat. Dass Jeremia eine Festung gegen die ungehorsamen Judäer ist, müssen wir auf Gott zurückführen, der der eigentliche Fels und die eigentliche Festung ist. König David hat seine militärischen Siege immer auf Gott zurückgeführt, der für ihn Stütze und Halt ist. Er hat verstanden, dass alles von Gott abhängt. So hat auch Jeremia gehandelt.
Gott ist Hoffnung und Zuversicht für den Psalmbeter schon von Jugend auf. Wir sehen König David vor uns, der schon in jungen Jahren Gottes Ruf gefolgt ist. Ihn hat er gesalbt und somit seinen Geist auf ihn gelegt. Er ist als Feldherr König Sauls und in jungen Jahren selbst König geworden. Bei allem, was er tat, vertraute er immer ganz auf Gott. In jungen Jahren ist auch Jeremia berufen worden zu einem Dienst als Prophet Gottes. Er hat bei seinem Wirken stets auf Gott vertraut. Beide sind als Typoi des Antitypos Johannes zu verstehen. Er ist nicht nur in jungen Jahren schon zum Zeugen Jesu Christi geworden wie die anderen beiden. Er bezeugte ihn bereits im Mutterschoß der Elisabet, als Maria sie besuchte. So wird Vers 6 dieses Psalms nicht nur im übertragenen Sinne verstanden, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Während Jeremia und David im Mutterleib schon zu einem besonderen Dienst berufen sind, wirkt Johannes schon im Mutterleib als Prophet. Er preist Gott bereits als Ungeborener, indem er vor dem ungeborenen Christus „tanzt“, das heißt hüpft, ganz als Antitypos Davids, der vor der Bundeslade getanzt und gehüpft hat.
„Für viele wurde ich wie ein Gezeichneter“. Das hebräische Wort כְּ֭מֹופֵת k’mofet ist eigentlich zu übersetzen mit „wie ein Wunder“ oder „wie ein gutes Vorbild“. Das kann König David wirklich von sich sagen. Er ist in vielen Aspekten zu einem Vorbild geworden: als König, in seinen militärischen Siegen, als frommer Jude, in seiner Gottesbeziehung. Und doch hat er all diese guten Eigenschaften nie auf sich selbst bezogen, sondern auf Gott zurückgeführt, der seine „starke Zuflucht“ ist.
König David als Psalmenbeter ist wirklich jemand, der den ganzen Tag vom Lobpreis Gottes erfüllt ist. Er hat König Saul schon viele Lieder auf der Laute gespielt. Er ist es, der den jüdischen Festkalender ausgebaut und so viele Lieder komponiert hat. Und doch ist Johannes ihm in einer Sache voraus: Er hat schon vor seiner Geburt mit dem Lobpreis und Tanz begonnen, im Gegensatz zu David.
In Vers 15 haben wir eine Art Gelübde vor uns, denn der Beter fordert sich selbst zum immerwährenden Lobpreis und Dank auf. Da Gott so viele Heilstaten begeht, kann der Mund nicht aufhören, von ihnen zu berichten. Gottes Gerechtigkeit ist zu überwältigend, als dass über sie auch nur ein Moment geschwiegen werden kann.
Gott selbst hat die Propheten gelehrt und erfüllt. Er hat ihnen die Worte in den Mund gelegt (siehe Jeremias Berufungsgeschichte) und mit dem Hl. Geist erfüllt. Bis zu ihrem Lebensende haben sie Gottes Wunder verkündet. Das betrifft David, Jeremia und Johannes den Täufer.
1 Kor 12-13
31 Strebt aber nach den höheren Gnadengaben! Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg:
1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
3 Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
7 Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
8 Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht.
9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden;
10 wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.
11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war.
12 Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.
13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
In der zweiten Lesung hören wir heute das Hohelied der Liebe. Es ist ein wunderbar poetischer Text über die Liebe, der sehr gerne bei Trauungen verlesen wird. Die letzten Sonntage hat Paulus seine Charismenlehre entfaltet und uns dabei gezeigt, dass jede Aufgabe, jedes Talent, jede Stärke in der Gemeinde Platz findet. Kein Mensch kann gar nichts. Jeder kann sich einbringen und die Gaben des Geistes sind ganz bewusst unterschiedlich verteilt, damit die Gemeinde aufgebaut werde. Heute fordert er dazu auf, nach den höheren Gnadengaben zu streben. Wir Christen müssen bei den Gnaden Gottes immer „ehrgeizig“ sein, sie also anstreben und sie erbitten. Es muss uns immer ein Anliegen sein, noch mehr in der Heiligkeit zu wachsen und dafür immer noch mehr Hilfsmittel zu erlangen. Dann zeichnet Paulus den überragenden Weg, der bei all diesen Bemühungen nie aus den Augen verloren werden darf: der Weg der Liebe.
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete“ bezieht sich auf das Charisma der Zungenrede, das er im Kapitel zuvor schon bei den Charismen aufgezählt hat. Einem Menschen bringt es nichts, dieses wunderbare Charisma zu besitzen, wenn der Mensch ohne Liebe ist. Dann ist sein Sprachengebet nur Lärm. Denn in Gottes Herrlichkeit des Himmels ist kein Platz für Lieblosigkeit. Die Sprache des Himmels tönt allein die Liebe. Andernfalls schießt man am Ziel vorbei.
„Und wenn ich prophetisch reden könnte“ drückt eine der höchsten Gnadengaben aus, wie Paulus im Kapitel zuvor herausgestellt hat. Dieses Charisma dient den Mitmenschen sehr im Gegensatz zur Zungenrede, die allein Gott gebührt, außer jemand kann sie deuten. Dann haben auch die Mitchristen etwas davon. Und selbst diese mächtige Gabe bringt dem Menschen nichts, wenn er nicht zugleich die Liebe hätte. Wer nämlich so eine Gabe aus Liebe einsetzt, wird damit nur Gutes bezwecken wollen. Wer sie aus falscher Absicht einsetzt, wird den zu dienenden Menschen nicht zum Himmelreich verhelfen. Deshalb ist der Prophet ohne die Liebe nichts.
Ebenso ist es mit dem Verschenken von Besitz. Das ist eine Tat, die allein aus Liebe geschehen muss, damit sie vor Gott Frucht bringt. Warum sollte man denn auch sein ganzes Hab und Gut verschenken, wenn nicht aus Liebe zu jenen, denen man den Erlös verschenkt! Alle anderen Absichten sind egoistisch und verwerflich. Sie werden den Christen nicht ins Himmelreich bringen, denn der Mensch ist dann nicht wirklich arm vor Gott. Diese Armut muss von Liebe getragen sein, sonst besteht sie gar nicht.
Und dann erklärt Paulus, was diese Liebe ist, die offensichtlich den charismatisch begabten Menschen fehlen kann:
„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.“ Diese Worte sind wunderbar und werden konkret, wenn wir auf den schauen, der sie am vollkommensten gelebt hat – Jesus Christus. Er ist so geduldig mit den Menschen, die immer wieder auf Abwege geraten. Er schlägt nicht drein und verbannt die Sünder endgültig, sondern tut und macht, damit sie bis zu ihrem Tod unzählige Chancen zur Umkehr erhalten. Wenn das kein Ausdruck von Langmut ist! Jesus hat sich nie ereifert, das war die Spezialität der Zeloten (ζηλωτής zelotes=Eiferer). Er hat Liebe statt Gewalt gewählt. Das hat ihn unattraktiv für jene gemacht, die Barabbas ihm vorgezogen haben. Jesus hat sich nie aufgebläht, denn er ist die Demut in Person. Seine Präsenz und die Aufmerksamkeit der Menschen musste er sich nicht erkämpfen. Sein ganzes irdisches Dasein bestand darin, das Reich Gottes zu verkünden und den Menschen das Heil zu schenken. Er hat nie seinen eigenen Vorteil gesucht, sondern sich ganz an die Menschheit verschenkt. Schließlich ist er für uns alle ans Kreuz gegangen. Und bis zum letzten Atemzug wurde er versucht und provoziert. Noch am Kreuz hängend verspotteten die Menschen ihn und sagten, er solle sich selbst helfen. Und doch ging er auf die ganzen Versuchungen nicht ein. Er hat sich nie zum Zorn reizen lassen. Diese Art von Zorn, die hier angesprochen wird, hat nichts mit dem Zorn Gottes zu tun. Vielmehr meint es den Affekt, der ein Laster ist, weil er überzogen und impulsartig ist. Er hat nichts mit der angemessenen und kontrollierten Reaktion Gottes auf Unrecht zu tun. Diese ist ja nichts Schlechtes. Menschlicher Zorn ist aber das Gegenteil von Liebe. Also können wir hier nicht einwenden, dass Jesus ja im Zorn die Händler aus dem Tempel vertrieben hat. Das war eine prophetische Zeichenhandlung, die geplant war und nicht aus dem Affekt heraus geschehen ist.
Jesus hat die Wahrheit nie verschwiegen, auch wenn er sie mit ganz viel Fingerspitzengefühl verkündet hat. Wenn ein Mensch gesündigt hat, hat er diesem die Sünden immer ganz klar vor Augen geführt, aber mit so viel Liebe, dass die Menschen bereut haben und umgekehrt sind. Zur Liebe gehört auch, die Wahrheit beim Namen zu nennen.
Jesus hat alles ertragen, was die Menschen ihm angetan haben, weil er die Menschen liebt. Er erträgt auch jetzt alles, was die Menschen heute in ihrer Sünde tun. Es schmerzt ihn sehr, denn es ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, ein Stich in sein brennendes Herz für uns. Und doch hört seine Liebe zu uns niemals auf. Gottes Bund währt ewig, weil er die Liebe ist und weil er unendlich ist. Wenn wir uns an Christus orientieren, werden wir die Liebe richtig begreifen und ebenfalls leben. Und diese muss stets Antrieb, Zweck und Ziel sein.
Denn wenn auch die Charismen aufhören – die Zungenrede, Prophetie oder Erkenntnis -, die Liebe bleibt. So ist es auch mit den göttlichen Tugenden „Glaube, Hoffnung und Liebe“. Glauben tun wir, solange wir dieses Leben beschreiten, hoffen können wir auf die Ewigkeit durch das Osterereignis. Beides fällt weg, wenn wir dann von Angesicht zu Angesicht mit Gott treten. Dann wird die Hoffnung erfüllt und wir kommen vom Glauben zum Schauen. Was dann bleibt, ist die ewige Liebe in Gottes Herrlichkeit.
Charismen sind nur Stückwerk, so Paulus. Sie sind es deshalb, weil der Mensch unvollkommen ist, auch der Charismatische. Wir bekommen Gottes Gnadengaben nicht erst, wenn wir heilig sind. Deshalb bewirken wir alles Charismatische wie durch ein gebrochenes Glas. Es geht immer durch unsere Unvollkommenheit. Die ganze Schöpfung ist gefallen und wie ein gebrochenes Glas, durch das wir nicht klar sehen. Paulus bringt dafür das Bild des Spiegels an. Erst am Ende der Zeiten werden wir klar sehen, weil wir vor Gottes Angesicht treten werden. Dann ist es wie der Prozess des Erwachsenwerdens. Was wir jetzt noch mit Kinderaugen erblicken, werden wir irgendwann mit erwachsenen Augen sehen. Dann werden wir einen Reifeprozess erfahren und die stückweise Erkenntnis wird vervollkommnet werden.
Paulus erklärt hier nicht nur, was die Liebe ist und wie entscheidend sie im Gemeindedienst ist. Er erklärt uns auch, dass dieses irdische Dasein vorläufig und bruchstückhaft ist. Was wir jetzt von Gott erkennen, ist noch unklar und nur ein Bruchteil von dem, was Gott wirklich ist. Irgendwann werden wir aber alles erkennen und dann wird nur noch die Liebe übrig bleiben.
Lk 4
21 Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
22 Alle stimmten ihm zu; sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten: Ist das nicht Josefs Sohn?
23 Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst! Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat!
24 Und er setzte hinzu: Amen, ich sage euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.
25 Wahrhaftig, das sage ich euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elija, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam.
26 Aber zu keiner von ihnen wurde Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon.
27 Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman.
28 Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut.
29 Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen.
30 Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg.
Die heutige Episode des Evangeliums schließt sich unmittelbar an die Worte der letzten Woche an. Jesus ist ganz erfüllt vom Hl. Geist. Er lehrt die Juden heute mit göttlicher Vollmacht. Er hat einen messianischen Ausschnitt aus dem Buch Jesaja vorgelesen und erklärt, dass die Verheißungen der Hl. Schriften sich in ihm erfüllen. Es gibt im Judentum eine Leseordnung und wir sehen einmal mehr, wie die Vorsehung Gottes alles fügt. Jesus ist ausgerechnet dann dran, wenn Jesaja verlesen wird, der die prägnanteste Messiaserwartung beinhaltet. Jesus liest Worte vor, die eins zu eins auf ihn zutreffen. Ihm ist klar, dass er sich selbst in Gefahr bringt, wenn er die folgenden Worte spricht, und doch sagt er sie: „Heute hat sich das Schriftwort (…) erfüllt.“ Das ist für jüdische Ohren, die Jesus als Gott nicht erkennen, absolut blasphemisch. Jesus bezeichnet sich als Gesalbten, was auf hebräisch Messias heißt. Zuerst sind die Anwesenden erstaunt und stimmen ihm zu. Sie werden von den vielen Wundertaten und der brennenden Verkündigung Jesu gehört haben. Sie werden von Blindenheilungen und von der frohen Botschaft Jesu Christi erfahren haben. Ihnen wird aufgefallen sein, welch Segen von diesem Menschen ausgeht. Und doch hält diese Anerkennung nicht lange an. Sie sind erstaunt, wie jemand, den sie als einfachen Sohn eines Zimmermanns ihrer Stadt kannten, plötzlich so redet. Jesus sagt daraufhin, weil er ihre Herzen kennt, dass ein Prophet in seiner Heimatstadt nicht anerkannt wird, eben aus jenem Grund: Die Leute haben ihn von klein auf aufwachsen gesehen und respektieren ihn deswegen nicht.
Wo Ablehnung herrscht, kann Gott nicht wirken. Das betrifft auch die Kirche heute. Wo die Menschen selbst und aus eigener Kraft etwas bewirken wollen, lassen sie dem Geist Gottes keinen Raum. Wenn sie ihn ablehnen, zieht er sich zurück, denn der freie Wille ist Gott heilig. So ist es auch bis zum Schluss. Wer den Hl. Geist ablehnt und so auch die vergebende Barmherzigkeit Gottes, richtet sich selbst für die Hölle. Denn der Geist Gottes ist es, durch den uns vergeben wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern als Auferstandener: „Empfangt den Hl. Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“
Diese allzu menschliche Haltung, die Jesus hier anspricht, gilt zu jeder Zeit. So verweist er auf die Witwe von Sarepta und den Syrer Naaman. Dieser nimmt es auch zuerst nicht an, lässt sich dann aber eines besseren belehren und so wird er doch geheilt. Zur Zeit der Propheten Elija und Elischa bleiben viele Heilungen aus, weil die Menschen nicht mit Glauben zu ihnen kamen und diese nicht anerkannten. Heilungen Gottes sind keine Automatismen. Wer innerlich gar nicht glaubt, dass Gott sie heilen kann, wird auch nicht geheilt. Wer nicht wenigstens ein wenig sein Herz dafür öffnet, an dem wird Gott auch nicht handeln können. Keiner wird gegen seinen eigenen Willen geheilt. Das gilt bis heute.
Jesus hat diese ganzen Worte nicht gesprochen, um irgendwen zu provozieren, sondern es stellt eine Lektion für die Menschen dar. Er sagt es, um sie wachzurütteln, damit sie ihn annehmen. Stattdessen werden sie wütend und wollen ihn umbringen. Jesus hat keine Angst und geht ganz gelassen durch die Menge hindurch weg. Sie haben die Zeit der Gnade nicht erkannt. Gott kritisiert die Menschen nicht, um sie fertig zu machen oder weil ihm das gefällt. Er tut es, um die Menschen zur Besinnung zu führen. Er weiß, was ihnen wirklich fehlt, er kann ihnen das lebendige Wasser aber nur zu trinken geben, wenn sie den Mund aufmachen und zu trinken beginnen.
Jeremia und Jesus – beide treten mit Vollmacht auf, wobei Jesu Vollmacht eine göttliche ist. Seine Autorität übersteigt alle Menschen, die bis dahin lebten. Gott selbst kommt, um seine Botschaft kundzutun, und doch erntet er dieselbe Reaktion wie so oft Jeremia: Die Menschen lehnen ihn ab. Sie hören nicht auf seine Worte. Jesus ist so wie Jeremia eine befestigte Stadt, ein starker Kämpfer für das Reich Gottes, ja sein Feldherr. Deshalb können die Menschen nichts gegen ihn ausrichten. Er geht gelassen weg. Er ist auch in dieser Hinsicht Antitypos Jeremias. Oft ist es so, dass auch wir als Zeugen des Evangeliums auf taube Ohren und harte Herzen stoßen. Doch auch dann sollen wir nicht nachlassen, nicht entmutigt werden und vor allem: in der Liebe nicht nachlassen, wie Paulus es im Hohelied der Liebe erklärt. Dabei sollten wir jederzeit vor Augen haben: die Liebe zu leben, kann uns ans Kreuz bringen – und wird uns ans Kreuz bringen, wenn auch im übertragenen Sinne. Doch nach dem Kreuz kommt die Auferstehung.
Ihre Magstrauss