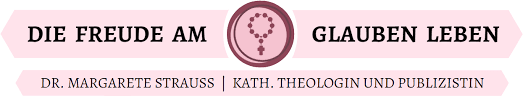Apg 22,30; 23,6-11; Ps 16,2 u. 5.7-8.9-11a; Joh 17,20-26
Apg 22
30 Weil er genau wissen wollte, was die Juden ihm vorwarfen, ließ er ihn am nächsten Tag aus dem Gefängnis holen und befahl, die Hohepriester und der ganze Hohe Rat sollten sich versammeln. Und er ließ Paulus hinunterführen und ihnen gegenüberstellen.
6 Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil zu den Sadduzäern, der andere zu den Pharisäern gehörte, rief er vor dem Hohen Rat aus: Brüder, ich bin Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern; wegen der Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht.
7 Als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern aus und die Versammlung spaltete sich.
8 Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gebe weder Auferstehung noch Engel noch Geist, die Pharisäer dagegen bekennen sich zu alldem.
9 Es erhob sich ein lautes Geschrei und einige Schriftgelehrte aus dem Kreis der Pharisäer standen auf und verfochten ihre Ansicht. Sie sagten: Wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen. Vielleicht hat doch ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen.
10 Als aber der Streit heftig wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Daher ließ er die Wachtruppe herabkommen, ihn mit Gewalt aus ihrer Mitte herausholen und in die Kaserne bringen.
11 In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Hab Mut! Denn so wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen.
Was sich die letzten Tage angebahnt hat, erfüllt sich nun. Paulus ist in Jerusalem angekommen und die Ältesten der Jerusalemer Urgemeinde schlagen ihm vor, ein Nasiräat zu unternehmen, damit sich die hiesigen Juden entgegen der Gerüchte von seiner Treue zum Gesetz überzeugen können.
Doch es kommt alles anders. Als er in den Tempel kommt, findet ein Aufruhr statt, die römischen Soldaten nehmen ihn fest, weil sie in ihm einen richtigen Aufrührer vermuten, fragen ihn aus, erlauben ihm daraufhin, vor dem versammelten Volk eine Verteidigungsrede zu halten und wollen ihn aufgrund der sich nicht beruhigenden Situation unter Geißelhieben befragen. Doch Paulus gibt ihnen zu verstehen, dass sie ungerecht gegen einen römischen Staatsbürger vorgehen. Dies rettet Paulus wiederholt das Leben. So müssen ihn die Soldaten freilassen, denn er ist ohne gerechten Prozess festgenommen worden.
Der Freigelassene möchte nun genau wissen, warum man ihn hatte festnehmen lassen. Deshalb geht er zum Hohen Rat und geht strategisch vor: So hält er eine Ansprache vor den versammelten Sadduzäern und Pharisäern, in der er das Thema der Auferstehung von den Toten anreißt. Damit bringt er DAS spalterische Thema in die Versammlung, denn während die Pharisäer an eine Auferstehung glauben, lehnen die Sadduzäer sie ab.
Dadurch, dass nun ein Tumult entsteht, bei dem die einen gegen die anderen ihre Ansicht verteidigen, stellen sich die Pharisäer hinter Paulus, der ganz bewusst seine eigene pharisäische Identität betont. Sie ziehen eine übernatürliche Begegnung bei dem Bekehrungserlebnis Pauli in Erwägung, da sie ja an Engel und Geister glauben (vom Messias sagen sie allerdings nichts hier). Der Streit wird aber nur heftiger und Paulus gerät total zwischen die Fronten. Man lässt ihn mit Gewalt herausholen und in die Kaserne bringen.
In diese brenzliche Situation hinein gibt Gott Paulus ein, dass er keine Angst haben muss. All dies werde sich lösen, sodass Paulus nach Rom gehen und den Herrn bezeugen wird. Das ist im Grunde schon eine Ankündigung seine Märtyrertodes, denn die Bezeugung wird bis aufs Blut sein (das griechische Wort ist μαρτυρία martyria!).
Was Paulus in Jerusalem durchmacht, ist in Analogie zum Geschick Jesu zu betrachten. Er ist dessen Apostel und braucht keine bessere Behandlung als sein Rabbi zu erwarten. Wie auch Jesus vor seinem Leiden hat er eine Abschiedsrede gehalten und sich dann auf den Weg in die Höhle des Löwen gemacht. Er stirbt keinen Sühnetod, aber der Hass über das Evangelium Jesu Christi ist derselbe.
Paulus ist mutig und lässt sich vor dem Hohen Rat nicht einschüchtern. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, mit dem er erfüllt ist. Möge Gott auch uns ausstatten mit seinen Gaben, damit auch wir so mutig für den Glauben einstehen, auch wenn wir dafür so einen Hass ernten wie Paulus in der heutigen Lesung!
Ps 16
2 Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein.
5 Der HERR ist mein Erbanteil, er reicht mir den Becher, du bist es, der mein Los hält.
7 Ich preise den HERRN, der mir Rat gibt, auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt.
8 Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht.
9 Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre, auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. 10 Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt; du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen.
11 Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen.
Als Antwort auf die Apostelgeschichte beten wir einen vertrauensvollen Psalm. Dieser ist schon bei der Festnahme des Petrus durch den Hohen Rat gebetet worden. Es ist dieselbe Situation – das Leiden für das Evangelium Jesu Christi. Und so wie Gott Petrus nicht im Stich gelassen hat und dieser ganz auf Gott vertraut hat, so ist auch Paulus ganz getragen von der wunderbaren Vorsehung Gottes.
Gott schenkt Freude. Das wird durch das Bild des Bechers ausgedrückt. Der Psalmist drückt sein Vertrauen auf Gott aus, das er die ganze Zeit nicht verloren hat. Der Psalm ist von König David, von dem wir sehr viele Situationen kennenlernen. So oft stand sein Leben auf der Kippe, doch weil er sich dann ganz an Gott geklammert hat, hat dieser ihn auch aus den Nöten herausgeführt.
Auch Christus hat ein solches Vertrauensverhältnis zum Vater gezeigt. Er, dessen Leben komplett auf der Kippe stand, dessen Leben wie das eines Verbrechers weggeworfen wurde!
Jesus hat bis zum letzten Atemzug dieses Vertrauen auf den Vater aufrechterhalten. Dieser war bis zum Schluss sein „ganzes Glück“.
Gott ist Davids Erbanteil – er versteht, dass die ganze Verheißung des Landes und eines Lebens in Fülle von Gott kommt. Er ist es, der Freude schenken kann und das Los jedes Menschen in Händen hält (der Becher, vor allem der gefüllte, ist Zeichen der Freude). Und eben dies hat Christus intensiviert auf einem Niveau, an das kein Mensch heranreicht. Die Freude, die er auch noch am Kreuz nicht verliert (es meint keine Emotion, sondern eine tiefe Gewissheit, dass am Ende alles gut wird), ist ein absolutes Vorbild für alle Leidenden. Der Vater hat ihm den Becher gereicht – nach dem bitteren Kelch kam der Freudenwein, der bis heute gefüllt wird in jeder Heiligen Messe! Damit verbunden ist der Erbanteil für das Reich Gottes, der jedem getauften Christen zugeteilt wird. Der Wein wird auf vollkommene Weise ausgegossen am Ende der Zeiten, wenn die Hochzeit des Lammes kommt. Dann wird eine ewige Freude sein, die nie mehr enden wird! Dann wird der Wein niemals ausgehen wie bei der Hochzeit zu Kana.
Gott ist es auch, der dem Menschen Rat gibt. Er tut es durch das Innere des Menschen. Wir sagen heute durch das Gewissen. Der Herr gibt es dem Menschen ins Herz, was er tun soll. Deshalb ist es wichtig, ein reines Herz zu behalten, stets im Stand der Gnade zu sein und ein geschärftes Gewissen zu haben (der Garant dafür ist das Sakrament der Versöhnung!). König David hat es selbst in den Nächten seines Lebens erfahren, das heißt vor allem im moralischen Sinne. Wenn er sich gegen Gott versündigt hat und die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommen hat, hat er sich dennoch nicht aufgegeben und sich noch mehr an den Herrn geklammert. Dieser hat ihn von der Nacht wieder in den Tag geführt.
Und von Jesus wissen wir von der tiefsten Nacht. Diese hat er am Kreuz verspürt, auch wenn es keine moralische Nacht ist. Er ist selbst zur Sünde geworden, gemeint ist das Kreuz, doch selbst hat er nie gesündigt. Er ist in die Nacht des Todes hinabgestiegen, um am Ostermorgen mit dem Sonnenaufgang von den Toten aufzustehen!
David hat den HERRN beständig vor Augen, dieser ist zu seiner Rechten. Diese Worte weisen über ihn hinaus auf den Messias, der nun wirklich nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt den Vater beständig vor Augen hat! Er ist zu seiner Rechten, wie wir im Glaubensbekenntnis beten.
Jesus ist der erste der neuen Schöpfung, der sich freuen kann, ewig beim Herrn zu sein. Ihm werden wir es gleichtun, wenn wir bis zum Schluss standhaft geblieben sind und von Gott heimgeholt werden in die himmlische Heimat. Dann wird auch unser Herz sich ewig freuen. Und am Ende der Zeiten wird auch mein und unser Fleisch in Sicherheit wohnen, wenn die Seele sich mit ihm wieder vereinen wird. Dann werden wir mit unserem ganzen Dasein bei Gott sein so wie Jesus und auch Maria.
Der Grund ist klar: „Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt; du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen.“ Wir müssen die Grube, die ewige Abgeschnittenheit von Gott und den seelischen Tod nicht schauen, der die Hölle ist. Wir dürfen leben. Das ist für uns der Grund für die unerschütterliche Hoffnung in unserem Leben. Es ist eine Freude, die uns schon in diesem Leben geschenkt wird, eine Gewissheit, die uns durch alles Leiden hindurchträgt. Diese Grube, die wir nicht schauen werden, daran glauben die Sadduzäer in der Apostelgeschichte nicht. Für sie ist alles mit dem Tod vorbei, nicht einmal die Grube wird es geben.
Und dabei hat Gott durch die Propheten des Alten Testaments und schließlich durch seinen eigenen Sohn den „Weg des Lebens“ aufgezeigt – die Lebensweise, die ein Leben nach dem Tod ermöglicht. Dieser Weg des Lebens ist es, den Paulus auf der ganzen Welt verkündigt und für den er solch heftigen Anstoß erregt. Sie haben die Zeit der Gnade nicht erkannt, wie sie es schon bei Jesus nicht getan haben. Dabei hat Jesus mit seinem ganzen Wesen kommuniziert, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
Joh 17
20 Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben.
21 Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.
22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind,
23 ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
24 Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt.
25 Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
26 Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin.
Im Evangelium hören wir wieder einen Ausschnitt aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu im Abendmahlssaal.
Jesus betet zum Vater, dass die gesamte Fürbitte nicht nur seine Apostel umfasst, sondern alle Christusgläubigen. Jesus möchte, dass sie alle gerettet werden. Er bittet im Voraus dafür und wird die Versöhnung dann durch seinen Kreuzestod besiegeln.
Er möchte, dass alle eins sind, wie er mit dem Vater und der Vater mit ihm. Die Einheit bezieht sich nicht einfach auf die Übereinstimmung von Meinungen und Einstellungen. Sie sollen aus demselben „Teig“ gemacht sein, dem Sauerteig des Reiches Gottes, also Teil der neuen Schöpfung im Heiligen Geist. Das heißt, dass Jesus hier beim Vater den Wunsch der Taufe für alle äußert. Sie sollen alle für die Ewigkeit leben und der Welt fremd sein (nicht von dieser Welt). Daraus ergeben sich dieselben Auffassungen und eine gemeinsame Einstellung. Wenn sie eine neue Schöpfung sind, werden sie auch anders leben, was den Außenstehenden auffallen wird. Sie lieben mit der Liebe des Vaters, den er seinem Sohn gezeigt hat und des Sohnes, die er dem Vater gegenüber gezeigt hat. Und sie lieben mit der Glut des Heiligen Geistes, der sie erfüllt, mit allen Geistesgaben ausstattet, in ihrem seelischen Tempel Wohnung nimmt und von dort aus die Gedanken, Worte und Werke der Getauften bestimmt. Wird dieser Geist in der Welt durch die neue Lebensweise der Christen sichtbar, werden die Menschen glauben, dass Jesus wirklich vom Vater gesandt worden ist, wie er während seines irdischen Aufenthaltes immer wieder gesagt hat. Sie werden nämlich die Liebe, die Gott in sich selbst ist, in der Gemeinde widerspiegeln. Sie wird wahrlich einen Spiegel des Wesens Gottes darstellen.
Jesus hat ihnen die Herrlichkeit gegeben, damit sie eins sind. Dies können wir in dieser Zeitform auf die Eucharistie beziehen, die er an dem Abend gestiftet hat. Sie etabliert nämlich die communio der Apostel, die Gemeinschaft. Wenn das Pfingstereignis kommt, wird diese Einheit noch vervollkommnet durch den Heiligen Geist. Dieser ist es, der die Gläubigen in Taufe und Firmung zu einer Glaubensgemeinschaft zusammenwachsen lässt als Leib Christi, den sie in der Eucharistie dann empfängt. Beides – die Speise und der Trank – verleihen den Gläubigen die Herrlichkeit des Himmels. Die Einheit der Gläubigen bezieht sich dann aber nicht nur auf die „horizontale“ Ebene (zwischenmenschlich), sondern auch auf die vertikale (zu Gott).
Jesus lässt in dem Gebet zum Vater auch durchblicken, warum er diesen Wunsch hat und ihn auch umsetzt durch sein Erlösungswirken: Er möchte, dass alle Menschen dort sind, wo er ist. Das meint die Liebesgemeinschaft mit dem Vater, der für Menschen nie in dem Maße wie bei Jesus erreichbar ist (weil Menschen Menschen bleiben und keine Götter werden!). Stattdessen werden sie hineingenommen in die Liebe zwischen Vater und Sohn. Moralisch wird dies als „Stand der Gnade“ bezeichnet. Mit dem Vater verbunden werden wir auch durch die Sakramente, allen voran durch die Eucharistie. Die Vereinigung mit Jesus bedeutet nämlich zugleich die Vereinigung mit der Heiligsten Dreifaltigkeit. Und wenn wir dann in diesem Liebeszustand sterben, werden wir auch da sein, wo Jesus ist – an der Seite Gottes im Himmelreich.
Jesus wünscht, dass alle Menschen seine Herrlichkeit sehen. Dies wird geschehen am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt auf die Weise, in der er in den Himmel aufgefahren ist – dann aber verherrlicht. Die Herrlichkeit Christi „schauen“ wir in verborgenem Zustand in der Eucharistie. Was unsere physischen Augen nicht sehen, sieht unser Glaube – die Vergegenwärtigung der brennenden Liebe Christi. Er war bereit, für uns zu sterben.
Auch wenn die Welt Jesus nicht erkannt hat – das meint wieder die gefallene Schöpfung -, so haben doch die Jünger Jesu erkannt, wer er ist bzw. wie die Liebe zwischen ihm und dem Vater ist. Das Erkennen hat eine tiefe Bedeutung, über die ich in den vergangenen Texten wiederholt gesprochen habe.
Jesus hat ihnen den Vater ganz geoffenbart. Er hat ihnen seinen Namen kundgetan, er, der die authentische Exegese des Vaters in Person ist. Sein Name, der schon Mose offenbart worden ist, ist seine Eigenschaft, immer für die Menschen da zu sein. Jesus hat ihnen die immerwährende Gegenwart Gottes stets bezeugt. Wie viele Zeichen und Wunder hat er tagtäglich erwirkt! Durch seine eigene göttliche Identität ist den Jüngern das auf ganz verdichtete Weise deutlich geworden! Gott ist nicht eine abstrakte Kraft, die irgendwo im Himmel schwebt, sondern er brennt so sehr in Liebe zu den Menschen, dass er ihnen so nahe wie möglich sein wollte. Deshalb hat er Fleisch angenommen! Das ist wirklich die absolute Offenbarung des Gottesnamens Jahwe („ich bin“). Nicht umsonst ist der Beiname des Messias auch Immanuel („Gott mit uns“).
Ihre Magstrauss