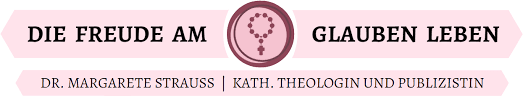1 Joh 2,3-11; Ps 96,1-2.3-4.5-6; Lk 2,22-35
1 Joh 2
3 Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote halten.
4 Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht.
5 Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet; daran erkennen wir, dass wir in ihm sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch einen Lebenswandel führen, wie er ihn geführt hat.
7 Geliebte, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt.
8 Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahre Licht schon leuchtet.
9 Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis.
10 Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und in ihm gibt es keinen Anstoß.
11 Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht.
Heute hören wir in der Lesung wie an den kommenden Tagen der Weihnachtsoktav aus dem ersten Johannesbrief. Dieser betrachtet vor allem die Liebe als konkrete Handlungsweise des Christen, nämlich als Halten der Gebote Gottes aus Liebe zu ihm.
Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, erkennt man daran, dass wir Gott erkannt haben. Das Erkennen meint in der Bibel einerseits das durch und durch vorliegende Kennen eines Menschen und die absolute Gemeinschaft, andererseits den ehelichen Akt, der wiederum die körperliche Ausdrucksform dieser absoluten Gemeinschaft darstellt. Wenn wir Gott also erkannt haben, sind wir durch und durch mit ihm in einer Liebesgemeinschaft.
Wir belügen uns aber selbst, wenn wir behaupten, ihn erkannt zu haben, aber gar nicht seine Gebote halten. Wer sich an Gottes Wort hält – und das meint nicht nur das von ihm Gesagte, das in der Bibel steht, sondern auch darüber hinaus! – in dem ist die Gottesliebe vollendet. Liebe ist immer etwas konkret Praktisches. In Gott sein bedeutet wiederum in johanneischen Schriften den Stand der Gnade.
In Gott sein bedeutet zugleich, ihm auf seinem Weg nachfolgen. Und Jesus Christus hat die Gebote nicht nur nicht abgeschafft, sondern auch mit seiner ganzen Person erfüllt. Er hat selbst vorgelebt, was er von seinen Jüngern erwartet – bis hin zum Kreuz. Gott lieben heißt also bis in die letzte Konsequenz, mit ihm gemeinsam gekreuzigt zu werden, um dann die Auferstehung zu erfahren.
Die Liebe ist ein uraltes Gebot, nichts Neues, das Johannes sich ausdenkt. Zugleich ist es ein neues Gebot, das Johannes den Adressaten schreibt. Wie ist das zu verstehen? Er spricht in dem Zusammenhang von Finsternis und Licht als zwei Zustände des Menschen. Es ist ein neues Gebot, die Liebe zu leben, weil es nun mit dem Versprechen des Neuen Bundes zu tun hat. In diesem Sinne ist es neu. Jene, die bereits zu diesem neuen Bund gehören, sind im Licht bzw. in denen leuchtet das wahre Licht bereits.
Das Problem ist, dass der neue Bund, der durch die Taufe eingegangen wird, nicht automatisch bestehen bleibt, sondern ein bestimmtes Leben erfordert. Der getaufte Mensch muss lieben, um im Licht zu bleiben. Wer dagegen hasst, ist noch in der Finsternis. Es gibt also keine Heilsgewissheit, wie sie manche Denominationen vertreten. Wer getauft ist und weiter an dem alten Leben festhält, kann nicht im Licht sein.
Die Finsternis hat es an sich, die Augen blind zu machen. Das Bild ist ideal um den Zustand der Todsünde zu umschreiben, denn dadurch stumpft der Mensch ab. Er verspürt nicht mehr, dass etwas an ihm nicht in Ordnung ist. Die Augen werden also nicht nur blind, sondern gewöhnen sich auch an die Dunkelheit.
Ps 96
1 Singt dem HERRN ein neues Lied, singt dem HERRN, alle Lande,
2 singt dem HERRN, preist seinen Namen! Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
3 Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern!
4 Denn groß ist der HERR und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter.
5 Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, aber der HERR ist es, der den Himmel gemacht hat.
6 Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht, Macht und Glanz in seinem Heiligtum.
Der heutige Psalm beginnt mit den signalhaften Worten „neues Lied“. Dadurch wissen wir, dass es messianische Aussagen geben wird:
„alle Lande“ sollen dieses Lied singen und Gottes Heilstaten sollen „bei den Nationen“ bekannt werden. Die nichtjüdischen Völker sollen nun auch diesen einen wahren Gott kennenlernen!
„Verkündet sein Heil“ wird dann für uns Christen auffällig christologisch, weil in den Worten „sein Heil“ hier wieder der Name Jesus enthalten ist. Während hier wörtlich das Heil Gottes als messianische Verheißung verkündet werden soll, sind wir Christen dadurch aufgerufen, Jesus Christus zu verkünden, der das Heil ist (Nomen est omen). Das ist einer der drei Hauptvollzüge der Kirche – die Verkündigung (martyria). Jeder einzelne Christ bezeugt dieses Heil durch sein Handeln. Wo wir einander lieben und die Gebote Gottes halten, kommt das Heil in die Welt, das Reich Gottes wird dann schon jetzt spürbar. Am Ende der Zeiten werden wir das Heil verkünden – aber als ewigen Lobpreis in Gottes Gegenwart, mit allen Engeln und Heiligen.
Der Psalm verrät auch mehr darüber, das in Jesaja noch zwischen den Zeilen steht: Gott ist der König, der Herrscher. Die messianische Erwartung geht über eine menschliche Figur wie Kyrus hinaus.
Gott ist „mehr zu fürchten als alle Götter“, denn diese gibt es nicht einmal. Zu König Davids Zeiten, als dieser Psalm geschrieben wird, ist die Erkenntnis noch nicht erlangt worden, dass es nur einen Gott gibt. Die Israeliten haben aber zumindest eine Monolatrie begriffen, eine Anbetung allein des Gottes Israels.
Es stimmt aber nicht ganz, dass monotheistische Tendenzen erst nach dem Exil aufkamen. Schon König David schreibt unter dem Einfluss des Hl. Geistes: „Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, aber der HERR ist es, der den Himmel gemacht hat.“ Selbst wenn diese Erkenntnis erst im Exil so richtig klar wird durch die sogenannte „Jahwe-allein-Bewegung“, erkennen wir schon hier die Erkenntnis, dass andere Götter Götzen sind. Das ist mit „Nichtse“ gemeint, menschengemachte Idole, die aber an sich tot sind. Sie können gar nichts bewirken im Gegensatz zum wunderbaren Schöpfer. Gott ist dagegen der Schöpfer, er ist also wahrlich ein Gott des Lebens, ein Creator. Er bringt hervor, was tote Gebilde nicht fertigbringen.
Hoheit, Pracht und Glanz sind Begriffe, die im Kontext dieses Psalms auf den Tempel zu beziehen sind. Dieser ist prunkvoll gebaut, viel Gold ist eingesetzt worden, wertvolles Holz, mit viel Detailliebe sind die verschiedenen Bereiche verziert worden. Gottes Gegenwart im Tempel ist wirklich von Hoheit, Pracht und Glanz umgeben. Doch darüber hinaus ist die wahre Hoheit, Pracht und der Glanz Gottes selbst zu nennen in seinem himmlischen Heiligtum! Seine Herrlichkeit selbst ist es, die hier so glänzt und leuchtet. Gott ist Licht, um es mit der Lesung zu sagen. Macht und Glanz sind also Begriffe, die vor allem den Gnadenreichtum betreffen. Beziehen wir es auf die Kirche, in der Gottes Gegenwart bis heute besteht, müssen wir also auch berücksichtigen, dass vor seinem Angesicht er viel Prunk und Pracht sieht, dies aber nicht das Entscheidende ist. Vielmehr sind die Gnade und Herrlichkeit Gottes entscheidend, die wir gar nicht sehen. Was wir davon erkennen, sind die Früchte.
Lk 2
22 Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen,
23 wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden.
24 Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
25 Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm.
26 Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe.
27 Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war,
28 nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten:
29 Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
30 Denn meine Augen haben das Heil gesehen,
31 das du vor allen Völkern bereitet hast,
32 ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
33 Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden.
34 Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, –
35 und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
Im Evangelium hören wir nun von einer Besonderheit, die die Heilige Familie betrifft: Sie erledigt zwei wichtige jüdische Gesetze: Erstens soll jeder erstgeborene Sohn und jedes erstgeborene Vieh, jede Erstlingsfrucht immer Gott zurückgegeben werden (Ex 13,2.12). Es soll als Zeichen der Dankbarkeit dem zurückgegeben werden, der es einem geschenkt hat. Den erstgeborenen Sohn kann man aber nicht darbringen wie das Vieh, denn Kinderopfer sind strengstens verboten. So wird stellvertretend für die Söhne ein Tier geopfert. Wer es sich leisten konnte, opferte ein Lamm, ärmere Familien opferten ein Paar Tauben. Maria und Josef waren nicht so reich, also brachten sie zwei Tauben dar. Das ist kein Zufall. Wir erkennen hier schon einen Verknüpfungspunkt mit der Taufe, wo auch eine Taube eine Rolle spielt! Und auch die Taufe ist ein Moment der Heiligung. „Taube“ und „Heiligung“ sind zusammenzubringen, weil der Hl. Geist die Heiligung bewirkt. Jesus gehört Gott und soll deshalb geopfert werden. Das ist schon ein Vor-Zeichen dessen, was wirklich passieren wird: Er wird im Gegensatz zu allen anderen Erstgeborenen nicht verschont, sondern wirklich geopfert – am Kreuz von Golgota.
Das zweite Gesetz ist die Reinigung Mariens nach der Geburt ihres Sohnes. Es meint keine hygienische Reinigung, sondern eine kultische. Das Gesetz bezieht sich auf Lev 12, wo die Wiedereingliederung der Frau in den Kult nach 40 Tagen geschehen soll. Diese Zahl hat eine tiefere Bedeutung, denn wie die Sintflut ohne Pause 40 Tage lang Regen auf die Erde fallen ließ, so muss auch Maria, die Arche des Neuen Bundes diese 40 Tage sühnen „wegen des vergossenen Blutes“ (Lev 12,5). Die Verbindung zur Sintflut wird dadurch hergestellt, dass laut Levitikus die Wiedereingliederung durch ein einjähriges Schaf oder durch ein Paar Tauben für Brand- und Sündopfer vollzogen wird. Auch bei der Sintflut kennzeichnet die Taube einen Neubeginn.
Maria wird gereinigt – es erfüllt sich die Verheißung aus dem Buch Maleachi. Sie trägt in sich das Blut der Stämme Juda und Levi. Sie ist biologisch gesehen priesterlich und königlich. Sie wird gereinigt, damit ihr Opfer Gott gefalle.
Danach wird von Simeon berichtet, der ein frommer Mann aus Jerusalem ist. Er lebte in einer intensiven messianischen Erwartung. Vom Hl. Geist erfüllt wird er in den Tempel geführt. Da, wo heilsgeschichtliche Knotenpunkte im Leben Jesu sind, ist immer der Hl. Geist im Spiel!
Simeon begegnet diesem Messias endlich, den er so viele Jahre ersehnt hat. In ihm erfüllt sich nun, was in Maleachi vorausgesagt worden ist: Der, den er gesucht hat, den er herbeigewünscht hat, ist endlich da. Er sieht ihn mit eigenen Augen so kurz vor seinem Tod. Es ist ein kleines Baby. Er nimmt es auf den Arm. Er berührt Gott selbst! Wie überwältigend muss es für diesen alten Mann sein, Gott in seinen Armen zu halten! Gottes Geist hat ihm zuvor schon verheißen, dass er ihm noch vor seinem Tod begegnen würde.
Sein Lobpreis beeindruckt die Eltern Jesu sehr. „Nun lässt du Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden“. Er kann nun in Ruhe sterben, weil sein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist. Es ist nicht einfach Geschwärme, sondern ein Bezeugen des Messias. Nun kann er in Ruhe sterben, weil er weiß, dass sein Volk Israel endlich erlöst werden wird.
„Denn meine Augen haben das Heil gesehen“, ja er hat Jesus wirklich geschaut, dessen Name „Jahwe ist Heil“ bedeutet. Sein Gebet ist eine Zusammenstellung verschiedener alttestamentlicher Verheißungen. Das ist ein typisches Kennzeichen für den Hl. Geist. Durch ihn wird man an die Verheißungen erinnert und zählt eins und eins zusammen. Es geht einem auf, was sich davon in dem Moment erfüllt. So ist es auch mit dem Magnificat, bei dem Maria verschiedene Schriftzitate neu zusammensetzt. Es ist auch dort der Geist Gottes, der dies in ihr bewirkt.
Simeon zitiert Jes 40,5 nach dem griechischen AT mit dem Sehen des Heiles. Und das Heil, das Gott „vor allen Völkern bereitet“ hat, ist ein Zitat aus Jes 52,10. Wir merken hier wieder die Betonung von Jesaja, dem am meisten messianischen Text des AT.
Auch gerade die Kombination von „Licht, das die Heiden erleuchtet“ und „Herrlichkeit für dein Volk Israel“ ist eine Zusammenstellung jesajanischer Schriftstellen (Jes 42,6; 46,13). Jesus ist gekommen, um einen Bund zu schließen gleichermaßen mit Juden und Heiden.
Simeon verheißt den Eltern Jesu die Bedeutung dieses Kindes: An ihm werden sich die Geister scheiden, denn viele werden durch ihn zu Fall kommen – nicht weil er dies aktiv tun wird, sondern weil sie ihn ablehnen werden. Aufgerichtet werden dagegen jene, die ihn annehmen werden. Die Aufrichtung ist ein Verb, das auf einen Bundesschluss hinweist. Die ihn annehmen, wir Getauften, sind mit Gott den Neuen Bund eingegangen.
Er ist auch zum Zeichen geworden, dem widersprochen wird: damals zu seinen Lebzeiten, im Nachgang auch als Zeichen des Kreuzes. In der Antike und bis heute lassen Christen ihr Leben für das Zeichen des Kreuzes.
Simeon hat auch eine Leidensankündigung für Maria bereit. Sie wird ein Schwert durchdringen. Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres für eine Mutter, als den Tod ihres eigenen Kindes mitanzusehen. Und dann wird ihr Sohn den schandvollsten Tod erleiden, er wird hingerichtet werden und muss viele Folterungen über sich ergehen lassen – als Unschuldiger. Und auch wenn sie dieses Schwert durchdringen wird, sie wird es annehmen und mit ihrem Sohn mitleiden. Sie wird es aushalten und bis zum letzten Atemzug ihres Sohnes unter seinem Kreuz stehen. Auch ihr Leiden wird etwas bewirken – nämlich die Offenlegung vieler Gedanken der Menschen. Auch an Maria werden sich die Geister scheiden – bis heute. Sie wird zum Maßstab der Rechtgläubigkeit, denn kein einziger Mensch kennt Jesus besser als sie. Wer Jesus mit ihren Augen sieht, sieht den echten Jesus, keinen ideologischen, zugeschnittenen Wunschjesus.
Einerseits sehen wir in Simeon, aber auch in Hanna, von der heute nicht mehr die Rede war, die Vertreter der Großelterngeneration. Mit ihnen können sich bis heute alle Großeltern identifizieren. Auch sie können im hohen Alter noch eine wichtige Berufung haben und sich einbringen. Auch diese haben eine ganz klare Berufung in der irdischen Familie und müssen nicht davon ausgehen, dass sie in ihrem Alter nichts mehr bewirken können.
Die zwei Gestalten verkörpern das Alte Israel, den Alten Bund. Sie stehen für das Volk Israel, das voller Sehnsucht auf den Messias wartet. Sie haben in steter Erwartung ihr Leben gelebt, um letztendlich an diesem Tag mit bereitem Herzen Jesus zu begegnen. Sie haben die Tore ihrer Seele geöffnet, dass Jesus in ihre Seelen einziehen kann. Es ist die Berührung der beiden Bünde, ein Übergang vom Alten zum Neuen Bund, der aber erst am Kreuz vollendet wird. Es ist ein Übergang vom Volk, das im Dunkeln lebt und nun ein helles Licht sieht. Jesajas Worte erfüllen sich nach so vielen Jahrhunderten!
Ihre Magstrauss