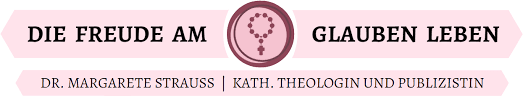Jes 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-2b.2c-3.4-5.7c-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11
Jes 6
1 Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus.
2 Serafim standen über ihm.
3 Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. / Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit.
4 Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch.
5 Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den HERRN der Heerscharen, haben meine Augen gesehen.
6 Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte.
7 Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen / und deine Sünde gesühnt.
8 Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich!
Auch an diesem Sonntag geht es um Berufung. Letzte Woche hörten wir in der ersten Lesung die Berufungsgeschichte Jeremias. Heute geht es um die Berufung Jesajas. Auch er hat eine Art Vision. Die hier beschriebene Schauung wird auch Johannes in der Offenbarung bekommen, wenn er den himmlischen Thronsaal Gottes zu sehen bekommt.
Zunächst wird das Ereignis in den Kontext der Geschichte Israels eingeordnet. Es geht um einen Gottesmann im 8. Jahrhundert vor Christus (Wirkungszeit wohl 734-701 v. Chr.), denn die Regierungsjahre der Könige Usija, Jotam, Ahas und Hiskija sind ziemlich gesichert.
Jesajas Vision im Todesjahr König Usijas beginnt damit, dass er Gott auf einem Thron sitzen sieht. Es liegt ganz auf der Linie der traditionellen Vorstellung, dass Gottes Gewand den Tempel überschattet bzw. Gott gleichsam auf dem Tempel thront, genauer noch auf der Bundeslade, dem Kern des Tempels. Wir müssen uns vorstellen, dass der Deckel der Bundeslade im Allerheiligsten ein Thron ist, der sogenannte Gnadenthron, von dem aus Gott mit Mose gesprochen hat („zwischen den Cherubim“, also den Engeln, die auf der Platte angefertigt worden sind). Diese Platte wird kapporet genannt, in der griechischen Übersetzung hilasterion. Paulus sagt im Römerbrief, dass Gott Christus zum hilasterion gemacht hat, indem Jesus zur Sühne unserer Sünden wurde – und damit zum Antitypos dieser Bundesladen-Platte, auf die der Hohepriester am Versöhnungstag das Blut von zwei Opfertieren besprenkelte. Diese Platte ist also der Gnadenthron Gottes, weshalb es im Psalter auch heißt, dass Cherubim Gottes Thron bilden, z.B. zu Beginn von Ps 99. Was im Tempel zu sehen ist, ist ja nach dem himmlischen Vorbild gebaut. Jesaja beschreibt also nicht einfach den Tempel, sondern eine wirkliche Himmelsvision, die sich mit dem Tempelbau deckt. Es gibt noch weitere Wendungen, die diese Vorstellung stützen, z.B. die Rede vom Schemel der Füße Gottes. Auch dieses Bild ist wie das des Throns Sinnbild seiner Herrschaft.
Die Serafim beten Gott mit dem dreimaligen Heilig an, etwas, das auch in der Johannesoffenbarung geschaut wird. Wir schließen uns diesem himmlischen Lobpreis an, wenn wir in der hl. Messe dreimalig heilig beten im Sanctus.
Wie auch in der Johannesoffenbarung und auch in Ezechiel wird Gottes Stimme als etwas sehr Erhabenes und Lautes wahrgenommen. Hier ist es aber eher der Seraf, der dem anderen das dreimalige Heilig zuruft. Wenn er spricht, wackeln die Türpfosten!
Der Rauch, der den Ort erfüllt, ist einerseits als Theophaniezeichen zu deuten, als Zeichen der Gegenwart Gottes, denn sowohl Rauch als auch Wolken werden in diese Richtung gedeutet. Viel gewichtiger ist allerdings eine andere Interpretation – eine kultische. Hier geht es um den Rauch eines Rauchopfers. Dies passt auch zum später erwähnten Altar und der Kohle, die zur Entzündung eines Rauchopfers notwendig ist. Der Thronsaal ist zugleich ein Tempel, so auch in den anderen Himmelsvisionen biblischer Propheten.
Jesaja ist richtig überwältigt von dem, was er schaut. Er meint, dass er nun sterben müsse, weil er Gott geschaut hat und eigentlich nicht würdig ist. Er spricht von unreinen Lippen. Es geht nicht darum, dass er sich selbst entwürdigt und schlecht macht, sondern seine absolute Unzulänglichkeit in der Gegenwart Gottes erkennt. So ist es bei Gott. Wir sehen uns in seinem Licht mit dem vollen Ausmaß unserer Unvollkommenheit.
Und dann geschieht etwas total Zeichenhaftes, das uns an Jeremias Berufung erinnert: Einer der Serafim kommt zu Jesaja und berührt seinen Mund mit einer glühenden Kohle. Dieser Vorgang ist ein Reinigungsprozess. Jesaja wird gereinigt im Sinne einer Entsühnung. Er wird fähig gemacht für seinen Prophetendienst. Es ist wie mit Jeremia, der seine absolute Unzulänglichkeit erkennt und seine mangelnden Kompetenzen aufzählt. Gott sagt diesem zu, dass er bei ihm ist und ihn befähigen wird. Und auch hier bei Jesaja kommt die Autorität, aber auch das Können von Gott. Gott sendet. Er sendet Jesaja, der freiwillig und mit eigenen Worten am Ende der Lesung zusagt: „Hier bin ich, sende mich!“
Was wir hier hören, ist auch der Kern des Weihesakraments: Die Apostel bekommen von Gott die Vollmacht, ihren Dienst in persona Christi zu tun. Sie sind gesandt – Christus sendet sie zunächst zu zweit in die umliegenden Dörfer und nach seiner Auferstehung kommt der große Missionsauftrag. Sie heißen Apostel, weil apostolos „Gesandter“ heißt. Sie sind nicht perfekt. Sie sind unvollkommen und schwach. Doch wie letzte Woche sage ich es auch hier: Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Er wird ihnen in allem beistehen, ihnen im richtigen Augenblick alles Nötige eingeben, ihnen alle Vollmachten verleihen.
Noch ein letztes kleines Detail. Gott sagt: „Wer wird für uns gehen?“ An mehreren Stellen lesen wir in der hl. Schrift einen Plural in der Gottesrede, so auch bei der Schöpfung. Wir dürfen solche Wendungen trinitarisch lesen. Gott ist in sich Gemeinschaft. Deshalb spricht er im Plural, nicht einfach als Pluralis majestatis, nicht einfach zu den anderen himmlischen Bewohnern, so als ob er mit den Cherubim und Serafim beraten würde.
Ps 138
1 Von David. Ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen, vor Göttern will ich dir singen und spielen.
2 Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin, will deinem Namen danken für deine Huld und für deine Treue. Denn du hast dein Wort größer gemacht als deinen ganzen Namen.
3 Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort, du weckst Kraft in meiner Seele.
4 Dir, HERR, sollen alle Könige der Erde danken, wenn sie die Worte deines Munds hören.
5 Sie sollen singen auf den Wegen des HERRN. Die Herrlichkeit des HERRN ist gewaltig.
7 Du streckst deine Hand aus, deine Rechte hilft mir.
8 Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Huld währt ewig. Lass nicht ab von den Werken deiner Hände!
Als Antwort beten wir Ps 138, einen Dankespsalm, der Gottes Macht in den Blick nimmt und den König David im Vorhof des Tempels vorgetragen hat. Immer wieder kommen königliche Aussagen zum Ausdruck, denn Gott ist ein König, wie auch Jesaja ihn geschaut hat.
„Ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen“. Wie gut ist unser Gott! Auch wenn wir seine Wege manchmal nicht verstehen, so hat er doch stets Pläne des Heils für uns, auch für Jesaja, der noch keine Ahnung hat, was auf ihn zukommt. Diese Worte können wir alle beten, denen uns das ewige Leben ermöglicht worden ist durch das Erlösungswirken Jesu Christi, das wir mit der Taufe angenommen haben.
„Vor Göttern will ich dir singen und spielen“ – das ist eine sogenannte monolatrische Aussage, also ein Hinweis darauf, dass zurzeit König Davids der klassische Monotheismus noch nicht verstanden worden ist. Man begriff bereits, dass der Gott Israels der höchste aller Götter sei, schloss die Existenz anderer Götter allerdings nicht aus. Schon bei David erkennen wir Ansätze einer Vorstellung, dass die sogenannten anderen Götter Nichtse sind, Götzen, die gar nicht existieren. Israel hat im Angesicht der anderen Völker mit ihren „Göttern“ dem einen Gott Israels gesungen und gespielt. König David ist dafür bekannt, dass er das Repertoire mit dem Psalter ausgebaut hat, ebenso die Gottesdienstpraxis und das liturgische Jahr. Er hat Chöre eingerichtet und den ganzen Lobpreis sowie die Wallfahrtsfeste systematisiert. Er ist vor der Bundeslade gehüpft und tanzte im Gotteslob. Sein Lautenspiel hat König Sauls Dämonen besänftigt.
„Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin“ – Diese Worte verraten uns, dass der Psalm in einem liturgischen Kontext gebetet worden ist. Seitdem es den Tempel aber nicht mehr gab und Jesus den Anbetungsort mit seiner Person verknüpft hat (nämlich vor der Frau am Jakobsbrunnen in Joh 4), beten wir den Psalm nun, indem wir uns vor Jesus Christus niederwerfen, dem wahren Anbetungsort mit eucharistischer Gegenwart hier auf Erden. Er ist der neue Gnadenthron geworden, die kapporet, das hilasterion, die „Sühneplatte“ des neuen Bundes. Er ist der Ort der Anbetung geworden. Und in der Ewigkeit braucht es dann nicht mal mehr einen Tempel, da Gott unverhüllt gegenwärtig sein wird.
„Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort.“ Gott erhört Bitten, immer. Die Art und Weise ist uns nur nicht immer bewusst, ebenso der Zeitpunkt seiner Erhörung.
Gott ist der eigentliche Herrscher. Alle irdischen Herrscher sind ihm unterstellt, weshalb die Könige der Erde ihm danken sollen. Er verleiht Macht und Autorität – nicht nur den Herrschern, sondern auch den Propheten, wie wir bei Jesaja gesehen haben!
David ruft die Herrscher zum Lobpreis Gottes und Halten seiner Gebote auf, wenn er von Gottes Wegen spricht. Gottes Herrlichkeit ist gewaltig, wie Jesaja voller Erschrecken festgestellt hat. Er ist so gewaltig, dass er hell leuchtet und überwältigend laut ist.
„Du streckst deine Hand aus, deine Rechte hilft mir.“ Diese Geste ist auf Gott bezogen sinnbildlich zu verstehen, denn er ist Geist. Er hat keine Hand, die er ausstrecken kann. Doch als menschgewordener Gott zeigt er uns diese Geste wortwörtlich. Wie oft werden wir Zeugen von Heilungswundern Jesu Christi, bei denen er seine Hand ausstreckt und die Menschen berührt. Sehr oft ergreift er die rechte Hand der zu Heilenden, sodass diese sich erheben können – so die tote Tochter des Jairus oder die Gelähmten.
Die Aussage in Vers 8 ist eine tiefe Vertrauensbekundung, dass Gott dem Beter helfen wird. Schließlich endet der Psalm mit der Bitte, auf ewig sein göttliches Wirken walten zu lassen. Gottes Taten sind so groß! Er hat immer wieder Überraschungen für den Menschen bereit und überschüttet ihn mit seinem Heil.
1 Kor 15
1 Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht.
2 Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen.
3 Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift,
4 und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift,
5 und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.
6 Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen.
7 Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln.
8 Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt.
9 Denn ich bin der Geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.
10 Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir.
11 Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt.
In der zweiten Lesung hören wir aus einem wichtigen Kapitel des ersten Korintherbriefes. Dort erklärt Paulus viele Aspekte zum Thema Auferstehung. Dabei betont er am Anfang, dass das Fundament des Glaubens, den auch die Korinther angenommen haben, die Osterbotschaft ist. Sie nämlich ist der Kern des gesamten Evangeliums.
Wer an diesem Evangelium festhält, wird gerettet werden. Die Bejahung des Evangeliums wiederum geschieht durch die Taufe als äußeres Zeichen des inneren Glaubens. Und deshalb wiederholt er es noch einmal, falls der ein oder andere diese Botschaft unüberlegt angenommen hat.
Dann hören wir aus der ältesten Osterüberlieferung, die das Neue Testament tradiert. Paulus selbst hat sie schon von woanders empfangen, also ist sie sehr alt, das heißt sehr nah an dem Osterereignis selbst dran.
„Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift“ – ja, das ist der Grund – entgegen aller theologischen Bemühungen heutzutage, den Sühnetod wegzuargumentieren und damit auch den typologischen Vergleich zur Sühneplatte der Bundeslade. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, für jeden einzelnen Menschen! Die Wendung „gemäß der Schrift“ verdeutlicht uns, dass es schon das Alte Testament angekündigt hat. Das ist wichtig, weil es den frommen Juden zeigt, dass Jesu Tod und Auferstehung heilsgeschichtlich entscheidend ist und sogar den Höhepunkt der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen darstellt.
„Jesus ist begraben worden.“ Das heißt, er war wirklich komplett tot, nicht scheintot, nicht ohnmächtig oder gar nicht erst gestorben. Er ist wirklich gestorben, was für unsere Erlösung absolut notwendig war. Er konnte nicht erlösen, was er nicht selbst durchgemacht hat. Deshalb musste er ganz sterben, um uns vom ewigen Tod zu retten.
Er ist dann aber am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift.“ Petrus hat diese Schriftstellen teilweise zitiert, als er am Pfingsttag vor die Menschen getreten ist. Jesus selbst hat dies angekündigt, indem er immer wieder Leidensankündigungen vorgenommen hat. Die Apostel haben es damals nicht verstanden, doch nun ist ihnen alles klar.
Er erscheint dem Kephas (also Petrus), dann den Zwölf, sogar 500 Brüdern gleichzeitig. Das kann also keine Einbildung sein, keine Fata Morgana oder Halluzination. Viele der Augenzeugen leben noch zur Zeit des Paulus. Mit Jakobus ist der „Herrenbruder“ Jakobus gemeint, der die Jerusalemer Gemeinde nach der Abreise des Petrus geleitet hat. Er ist Verwandter Jesu, deshalb heißt er auch „Herrenbruder“. Wir wissen von dem biblischen Zeugnis, dass es sich dabei um den Sohn einer anderen Maria und des Kleopas handelt, der übrigens einer der Emmausjünger ist. Diese andere Maria kann kaum die Schwester der Mutter Jesu sein (diese war laut Protevangelium des Jakobus ohnehin Einzelkind). Es wird sich vielleicht um die Cousine der Mutter Jesu gehandelt haben, also ist Jakobus Jesu Cousin zweiten Grades. Und doch ist es im orientalischen Kontext normal, Bruder zu sagen (Es gibt damals auch nur ein Wort für Bruder, Cousin etc.). Mit „Familie“ ist mehr gemeint als die gerade Linie, wie wir es aus unserem Kulturkreis kennen. Damit ist vielmehr die Großfamilie gemeint.
„Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt.“ Das bezieht sich auf Pauli Begegnung mit Christus vor den Toren von Damaskus. Paulus nennt sich einerseits Missgeburt, weil er sich selbst als den geringsten Apostel erachtet. Er hat schließlich die Christen zunächst verfolgt und somit Christus selbst verfolgt. Er nennt sich andererseits so, weil das griechische Wort ἔκτρωμα ektroma „unzeitige Geburt“ heißt. Es bezieht sich aber in seinem Fall nicht auf die biologische Geburt, sondern auf die Wiedergeburt im Hl. Geist. Seine Bekehrung kommt spät, ist also unzeitig im Gegensatz zu den anderen Aposteln.
Paulus macht sich nicht schlecht. Er sieht sich einfach mit den Augen Gottes. Aus sich selbst heraus hat er Schaden angerichtet. Gott Gottes Gnade hat in ihm die Bekehrung erwirkt. Er hat ihn wortwörtlich umgehauen. Auch er hat die Herrlichkeit Gottes so intensiv wahrgenommen, dass er sogar tagelang blind war. Gott hat einen solchen Christenverfolger zum Völkerapostel berufen. An Pauli Beispiel sehen wir ganz intensiv diesen Grundsatz: Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. In seinem Fall geht es weniger um fachliche Kompetenz, denn die hat er allemal als Pharisäer. Es ist die Rechtfertigung, die Entsühnung, was uns wieder zu Jesaja zurückführt. Ihn hat Jesus auf andere Weise angerührt und doch ist er gerechtgemacht worden für den Aposteldienst. Er ist von seiner Sünde gereinigt und mit der Vollmacht Gottes ausgestattet worden.
Und dann sagt Paulus das Katholischste, das man sagen kann – entgegen der protestantischen Engführung, die ihn auf das sola gratia beschränken will: „Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir.“ Es ist ein Teamwork. Wir sollen alles geben, was wir können. Die Gnade Gottes geht bei allem voraus und erledigt den Rest.
Zum Schluss sagt Paulus noch ein wichtiges Wort: Es spielt keine Rolle, ob er selbst diese Botschaft verkündet oder ein anderer. Es ist und bleibt dieselbe Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod. Diese Wendung formuliert er deshalb, weil es in Korinth ja die Rivalitäten und Parteien gibt (die einen halten zu Paulus, die anderen zu Apollos, die anderen zu Kephas…).
Lk 5
1 Es geschah aber: Als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Gennesaret
2 und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze.
3 Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus.
4 Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus!
5 Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.
6 Das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische; ihre Netze aber drohten zu reißen.
7 Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken.
8 Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir; denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr!
9 Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten;
10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du Menschen fangen.
11 Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach.
Im heutigen Evangelium hören wir ebenfalls eine Berufungsgeschichte, die der „Menschenfischer“, denen Jesus ihre Aufgabe schon vormacht, bevor er sie beruft. Jesus steht am See Gennesaret, weil die Menschenmenge Jesus hören möchte. Da erblickt er zwei Boote am Ufer und Fischer, die ihre Netze waschen. Kurzerhand steigt Jesus in das Boot des Simon (dem späteren Petrus) und lehrt von dort aus die Menschenmenge. Es ist kein Zufall, denn er wird diese Fischer als seine Apostel auswählen. Sie sollen so wie er vom Boot aus nicht mehr Fischernetze auswerfen, sondern das Wort Gottes ausstreuen, um nicht mehr Fische, sondern Menschen für das Reich Gottes zu „fangen“. Fischer sind wie Hirten sehr einfache Berufe, die von Menschen mit geringem Bildungsgrad ausgeübt worden sind. Das schließt jedoch nicht die religiöse Bildung ein, welche in der Regel sorgfältig vonstatten geht. So wie einfache Hirten die ersten Zeugen der Geburt Christi darstellten, so sind es jetzt einfache Fischer, die zur Nachfolge Christi berufen werden.
Bevor Jesus aber irgendetwas zu den Fischern sagt, fordert er Simon auf, mit dem Boot auf den See hinauszufahren. Das ist keine willkürliche Sache, sondern Jesus möchte den anwesenden Fischern nun erklären, was es heißt, Menschen zu „fangen“, das heißt für das Reich Gottes zu gewinnen. So fordert Jesus die Apostel dazu auf, die Netze auszuwerfen – mitten am Tag. Manchmal verlangt Gott Dinge von uns, die in unseren Augen sinnlos oder banal erscheinen, weil wir den tieferen Sinn dahinter nicht erkennen. So möchte Jesus ihnen zeigen, dass mit seiner Hilfe alles möglich ist. Sie haben in der letzten Nacht nämlich nichts gefangen. Sobald sie nun aber gehorsam Jesu Worte befolgen und die Netze auswerfen, fangen sie so viele Fische, dass die Netze fast reißen und sie nur gemeinsam die Beute an Land ziehen können. Petrus erkennt, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern Gott. Deshalb sagt er zu ihm: „Geh weg von mir, ich bin ein Sünder.“ Er fühlt sich in seiner Gegenwart plötzlich ganz klein und bedürftig. Es ist wie mit Jesaja, der ganz überwältigt von der Herrlichkeit Gottes seine eigene Erbärmlichkeit erkennt. Es ist ein Moment der Demütigung im positiven Sinne. Man schaut der Realität ins Auge, um einen klaren Selbstblick zu bekommen. Nur mit diesem können die Berufenen ihre Berufung richtig leben.
Alle Fischer sind ergriffen von dem, was passiert ist. Jesus ruft sie zur Nachfolge auf und sie lassen alles zurück, um ihm nachzufolgen.
Bei diesen Männern erkennen wir noch einmal, dass Gottes Maßstäbe ganz andere sind als unsere. Er sucht sich nicht die Elite der Gesellschaft aus, sondern ungebildete Fischer. Gewiss kommen noch gebildete Leute dazu, aber an dieser Szene erkennen wir, dass Gott unvollkommene Menschen erwählt, die sich bemühen werden – zusammen mit der Gnade Gottes, wie Paulus es so schön gesagt hat. Es sind gerade Petrus und die Zebedäus-Brüder, die Jesus zu ganz entscheidenden Ereignissen mitnimmt – einfache Fischer.
Aber warum sucht Gott sich nicht perfekte Menschen aus? Wir sollen erkennen, dass alles Gute, was sie bewirken, das Werk Gottes ist. Die Menschen sollen sich nichts auf sich selbst einbilden. Sie sind Werkzeuge Gottes, deren Fähigkeiten Gott nutzt, um den Menschen seine Herrlichkeit zu erweisen. Sie sollen ganz durchsichtige und klare Fensterscheiben sein, die das Licht Gottes ungebrochen in die Welt hineinstrahlen lassen, die Schönheit der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus auf vorzüglichste Art offenbart hat. Das ist das Leben von Berufung: sich von Gott gebrauchen lassen und alle Fähigkeiten in seinen Dienst stellen, schließlich hinter dem Verkündeten zurücktreten. Es geht um ihn, nicht um uns.
Ihre Magstrauss