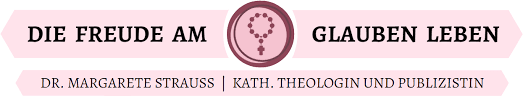Ez 34,11-16; Ps 23,1-3.4.5.6; Röm 5,5b-11; Lk 15,3-7
Ez 34
11 Denn so spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern.
12 Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben.
13 Ich werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus den Ländern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes.
14 Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden.
15 Ich, ich selber werde meine Schafe weiden und ich, ich selber werde sie ruhen lassen – Spruch GOTTES, des Herrn.
16 Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Ich werde es weiden durch Rechtsentscheid.
Heute am Hochfest des heiligsten Herzens Jesu geht es um die große Sorge, die Gott um uns hat, seine übergroße Liebe, mit der er jeden einzelnen Menschen zu sich ruft. Der Mensch ist aus Liebe geschaffen und dazu berufen, in die Gemeinschaft der Liebe, die Gott in sich selbst ist, hineingenommen zu werden. Deshalb hören wir viele Lesungen zum Hirtenthema. Gott als guter Hirte umschreibt dieses übergroße Herz, das auch in der geöffneten Seitenwunde Christi zum Ausdruck kommt. In der ersten Lesung hören wir aus dem Buch Ezechiel. Dort spricht Gott von sich selbst als Hirte seiner Schafe, die die Herde „Israel“ bilden. Das Kapitel steht im größeren Kontext verschiedener Gerichtsreden gegen verschiedene Personengruppen. Hier haben wir aber schon verheißungsvolle Worte an jene, die gerecht geblieben sind und unter der Gottlosigkeit der bösen Schafe leiden.
Gott selbst wird sich um seine Schafe kümmern wie ein Hirt. Er kündigt an, dass es einen Tag geben wird, an dem er „inmitten seiner Schafe ist“. Das werden die Juden jener Zeit zunächst als Verheißung verstanden haben, dass Gottes Gegenwart zu seinen Schafen zurückkehren wird in Form eines neuen Tempels. Hier bildet ja die Babylonische Gefangenschaft den historischen Kontext und im Zuge der Invasion der Babylonier wurde der erste Tempel zerstört, für die Israeliten die Botschaft, dass Gott seine Sachen gepackt und ihre Mitte verlassen hat – traumatisch!
Umso heilvoller erklingt diese Zusage Gottes in ihren Ohren, doch wir sehen darüber hinaus den tieferen geistlichen Sinn. Es ist die messianische Ankündigung, dass Gott so weit gehen wird, Mensch zu werden und unter den Menschen zu leben, als guter Hirte, wie Christus im Johannesevangelium von sich sagt.
Schon zu jener Zeit sammelt Gott sein Volk zusammen, das Volk des neuen Bundes. Wie ein guter Hirte alle verirrten Schafe zurückbringt, so holt Christus durch seine Erlösung die verirrte Menschheit zurück in die Heimat der Gottesgemeinschaft. In der Taufe nehmen die Menschen diese Erlösung an und erhalten den Stand der Gnade. Diese Aussage ist aber auch anagogisch zu deuten, denn mit seinem zweiten Kommen wird er alle Menschen der Erde sammeln zum Weltgericht.
Was hier noch zukünftig formuliert wird, ist für uns bereits geschehen, als Christus zum ersten Mal gekommen ist. Er wird wiederkommen, um die Welt zu richten und dann zum himmlischen Weideplatz zu führen. Es wird ein Ort der Ruhe sein, an dem der getriebene Mensch dieses irdischen Daseins wirklich ankommt.
Hier ist wörtlich zunächst die Sammlung der Juden in der Diaspora gemeint, die aufgrund des Exils fernab von ihrer Heimat leben müssen. Das ist nicht einfach nur eine Unannehmlichkeit und der Verlust irdischer Heimat, sondern vielmehr der Verlust der größten Gottesgabe – das verheißene Land, das Gott seinem Volk gegeben hat nach den Irrungen und Wirrungen der vierzigjährigen Wüstenwanderung. Und doch ist dies genau genommen ein Vorausbild für den eigentlichen Antitypos: das verheißene Land des Himmelreichs, die eigentlich größte Gottesgabe.
Gott möchte, dass möglichst alle Menschen gerettet werden. Deshalb geht er jedem verlorenen Schaf dieser Herde nach, damit es heile auf dem Weideplatz ankommt.
Gott wird für Gerechtigkeit sorgen: Wer unterdrückt worden ist, leidet und krank ist, wird in die Freiheit geführt, getröstet, gestärkt und gesund gemacht. „Doch das Fette und Starke“ wird er vertilgen. Das sind jene, die die Unterdrücker, Leidensbringer, Ungerechten und Gottlosen darstellen. Wer sich böse verhalten hat, wird auch den Preis dafür zahlen. Gott richtet nach den Taten der Menschen. Er wird scheiden zwischen Guten und Bösen, bevor das ewige Heil kommt. Denn nichts Böses kann ins Himmelreich gelangen. Diese Verheißungen und Gerichtsworte richten sich vom Wortsinn her zunächst an das vertriebene Gottesvolk und seine Feinde, doch darüber hinaus ist es wie oben beschrieben in den verschiedenen geistlichen Schriftsinnen auf uns alle zu beziehen, die wir moralisch gesehen auf Abwege geraten können und zur Umkehr gerufen sind, dies besonders aber durch die Taufe, auf dass wir überhaupt zu seiner Herde gehören und am Ende unseres Lebens in das verheißene Land des Himmelreichs kommen dürfen.
Ps 23
1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3 Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.
4 Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.
5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher.
6 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten.
Wir beten den berühmten Psalm 23. Er passt perfekt zur Lesung, weil in diesem Vertrauenspsalm Gott als Hirte beschrieben wird.
Gott ist unser Hirte, der uns alles gibt, was wir brauchen. Es mangelt uns an nichts, wenn wir zuerst sein Reich suchen. Das sagt Jesus später nicht umsonst. Gott lässt uns, seine Schafe, auf grünen Auen lagern. Er führt uns nicht ins Verderben, sondern nährt uns immer ausreichend, damit wir auf dem Weg durchs Leben hin zu ihm nicht zugrunde gehen. Auch wenn es zeitweise Wüstenlandschaften sind und nicht die grünen Auen, ist es für uns heilsam, damit wir die Auen wieder mehr zu schätzen lernen, in unserem Glauben gestärkt und in unserer Wachsamkeit geschärft werden. Konkret heißt das, dass Gott uns mit allen irdischen Gaben (Finanzen, Gesundheit, Nahrung und sauberes Trinkwasser, Frieden, Erfolg etc.), aber auch mit allen überirdischen Gaben ausstattet, die wir durch die Heilsmittel der Kirche erhalten. Dazu gehören die Sakramente, allen voran die Eucharistie, und die Sakramentalien, durch die er uns den Hl. Geist senden möchte. Nicht umsonst betet David zuerst „er lässt mich lagern auf grünen Auen“ und dann „und führt mich zum Ruheplatz am Wasser“. Es sind einerseits zwei Bilder für das Essen und Trinken des Menschen, andererseits die Bilder für die wichtigsten überirdischen Güter – die Eucharistie und der Hl. Geist, das lebendige Wasser, wie se uns vor allem in der Taufe geschenkt wird. Diese sind uns Wegzehrung, Proviant unterwegs in die himmlische Heimat. Sie führen uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott.
Gott bringt die Lebenskraft zurück. Das hebräische Stichwort ist an dieser Stelle wie so oft nefesch. Gott bringt das ganze Leben zurück. Wir dürfen es sowohl moralisch als auch anagogisch verstehen, das heißt einerseits die Rückführung in den Stand der Gnade und zugleich die Rettung des ewigen Lebens. Vor allem die moralische Ebene wird uns klar, wenn wir danach lesen: „Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit.“ Anagogisch beziehen wir es auf die Auferstehung. Es ist am Ende der Zeiten eine leibliche Auferstehung, weil der Mensch kein geteiltes Wesen ist. Diese leibliche Auferstehung sehen wir bereits an Jesus Christus, dessen Grab leer war und der mit Leib und Seele zum Vater heimgekehrt ist. Wir sehen es auch an Maria, der zweiten österlichen Person, die ganz in den Himmel aufgenommen worden ist. Der Anfang ist markiert, der Zusammenhang hergestellt. Wenn wir auf den Tod und die Auferstehung Christi getauft sind, dann ist die letzte Konsequenz auch die leibliche Auferstehung.
Selbst der Psalm 23 greift die Situation auf, dass es nicht immer die ruhigen grünen Auen sind, auf denen die Herde sich bewegt, sondern auch mal das finstere Tal. So ist das Leben. Es gibt nicht nur schöne Tage, sondern auch die Krisen und dunklen Stunden. Doch selbst da begleitet Gott einen hindurch und hinaus. David selbst hat dunkle Stunden gehabt, doch gerade in diesen hat er sich umso mehr an Gott geklammert. Er wusste, wie entscheidend sich die Qualität eines Hirten in finsteren Tälern herausstellte. Er wusste auch, wie sicher sich ein Schaf bei einem guten Hirten fühlen konnte. Er ist in dieser Hinsicht nicht nur der Typos des guten Hirten Christus, sondern auch des Lammes Gottes, das sich ganz und gar in die Hände Gottes übergab und selbst am Kreuz noch betete: „Vater, in deine Hände lege ich mein Leben.“ Von David können wir das absolute Gottvertrauen lernen und mit ihm zusammen beten: „Dein Stock und dein Stab trösten mich.“ Ein besonders finsteres Tal erleben die Israeliten im Babylonischen Exil. Und da offenbart sich Gottes Hirtenqualität auf besonders eindrückliche Weise. Er wählt in den Gottessprüchen, die Ezechiel vermittelt, nicht umsonst das Bildfeld von Hirt und Herde.
Gott beschenkt uns, seine Kinder. Er hat nur Gutes für uns bereit. All der Segen Gottes wird hier mit verschiedenen Bildern umschrieben wie dem Decken des Tisches, dem Salben des Hauptes und dem übervollen Becher. All dies können wir zusammenfassen mit den darauffolgenden Worten: „Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang.“
Ins Haus des Herrn heimzukehren, bedeutet in diesem Kontext wörtlich den Tempel Gottes, der zu Davids Zeiten noch in Form des Offenbarungszeltes bestand. Wir lesen es auch als Verheißung des Exilsendes für die Israeliten. Wir lesen dies allegorisch weiter als das Reich Gottes und die Kirche. Moralisch verstehen wir damit unsere eigene Seele, die der Tempel Gottes ist und von wo aus die Entscheidungen zu einem Verhalten nach seinen Geboten getroffen werden. Schließlich kehren wir am Ende unseres Lebens heim in das Haus Gottes, den Himmel.
Röm 5
5 Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
6 Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben.
7 Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen.
8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
9 Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden.
10 Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben.
11 Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben.
In der zweiten Lesung reflektiert Paulus die Hingabe Christi bei seiner Erlösungstat. Gottes große Liebe, die sein Herz uns zeigt, will er in der Taufe auch uns geben, damit wir mit derselben vollkommenen Liebe einander lieben.
Christus ist für die Gottlosen gestorben. Was möchte Paulus damit sagen? Jesus hat selbst einmal gesagt: „Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken.“ Jesus ist gekommen, damit die Ungerechten gerechtfertigt werden können. Konkret: Damit die Vergebung der Sünden erlangt werden kann für jene, die gesündigt haben. Doch nun der springende Punkt, den Paulus auch schon in den Kapiteln zuvor herausgestellt hat: Alle haben gesündigt. Es gibt nicht einen Menschen, der perfekt ist. Das liegt daran, was Adam und Eva getan haben. Durch sie kam die Sünde in die Welt und jeder Mensch ist durch diese innerlich zerbrochen. Dies zeigt sich in der Neigung zur Sünde. Also kann kein Mensch von sich behaupten, zu den Gesunden zu gehören oder zu den vollkommen Gerechten. Jeder Mensch ist durch die Erbsünde erlösungsbedürftig. Und deshalb ist Jesus für die ganze Menschheit gestorben.
Und deshalb erklärt Paulus, dass Jesus für die damals noch Gottlosen gestorben ist. Das bezieht sich auf die ganze Menschheit, die vor Gott nicht gerecht sein konnte wegen der Erbsünde.
Was Jesus getan hat, ist menschlich gesehen unbegreiflich. Paulus vergleicht seine Tat mit dem Heldentod von gewöhnlichen Menschen, die für Gute vielleicht noch ihr Leben hingeben würden, aber nicht für jene, die sie am liebsten auf den Mond schießen möchten.
Paulus‘ Hauptanliegen ist es, die Bedeutung der Erlösung aufzuzeigen: Keiner, auch nicht jene radikalen Judenchristen, mit denen er sich anlegt, können von sich aus sagen, dass sie vor der Taufe irgendwie besser dastehen als die Heiden. Und so wie die Voraussetzungen für alle dieselben sind, ist auch die Erlösung für alle gleich in der Wirkung. Durch das Blut Christi werden alle Menschen gleichermaßen vor dem Zorn Gottes gerettet. Dies geschieht darin, dass wir in der Taufe diese Erlösung annehmen. Der Zorn Gottes ist die Verurteilung der Sünden. Wie hätten wir diese Verurteilung mit unserer gefallenen Natur aus eigener Kraft je abwenden können! Die Folgen der Sünde, die Schäden, die Konsequenzen – sie sind so überwältigend und groß, dass sie den Menschen nur in eine Überforderung stürzen können.
Im Gegensatz zum Tun-Ergehen-Zusammenhang – Böses verdient Strafe und Gutes verdient Belohnung – erweist Gott hier jenem Gutes, der es gar nicht verdient hat! Die Barmherzigkeit Gottes ist wirklich überwältigend für Menschen. Das können wir auch auf Israel zurückprojizieren. Dass Gott mit seinem Volk am Sinai den Bund schließt, hat es sich nicht verdient. Gott schließt aus Gnade diesen Bund. Wenn Israel bekommen hätte, was es eigentlich verdient hätte, würde es zu jenem Zeitpunkt gar nicht mehr bestehen….
Die Taufe ist heilsnotwendig. Wenn wir das ewige Leben haben wollen, müssen wir vor Gott gerecht sein. Das geht nur, wenn wir in seinem Blut gereinigt sind. Und dies lassen wir durch die Taufe an uns zu. Und am Ende unseres Lebens wird Gott uns dann danach fragen, was wir aus diesem absoluten Gnadenakt, bei dem er seine Gnade in uns eingegossen hat, gemacht haben.
Paulus argumentiert sogar noch so: Wenn Gott uns als Gottlose schon so gut behandelt hat, wie sehr wird er uns dann behandeln, wenn wir als seine Kinder gestorben sind! Dann wird er uns das ewige Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm schenken.
Und statt uns unserer eigenen Taten zu rühmen, sollen wir uns Jesu Christi rühmen, der unser Gerechtsein vor Gott ermöglicht hat. Dieses „Rühmen“ wirft er zurück auf jene, die sich der Torah und Beschneidung vor der Taufe rühmen, als ob sie dadurch bessere Erlöste sind als jene, die zum Zeitpunkt der Taufe unbeschnitten sind. Alles Rühmen muss auf Gott selbst zurückgehen, weil nur er Gerechtigkeit ermöglicht.
Durch Christus haben wir jetzt schon die Versöhnung empfangen. Das „schon jetzt“ weist auf die Zukunft hin, wenn wir nämlich nach dem Tod vor Gott treten. Zwischen Taufe und Tod vergeht in der Regel noch eine Weile. Was wir aus der Taufgnade gemacht haben, das wird uns Gott dann in dem Moment des Gottesgerichts vorhalten.
Lk 15
3 Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte:
4 Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?
5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern,
6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war!
7 Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben.
Heute hören wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das zu einer Reihe von Gleichnissen gehört, in der es um verlorene und wiedergefundene Dinge geht.
Die Ausgangssituation ist folgende: Viele Zöllner und Sünder kommen zu Jesus, um ihn zu hören. Sie kommen mit der Bereitschaft, sich von ihm verwandeln zu lassen und ein neues Leben anzufangen. Der Wille zur Umkehr ist da. Dies greift Jesus gerne auf und verkündet ihnen das Evangelium. Doch nicht alle sind damit einverstanden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nehmen daran Anstoß, nicht nur, weil Jesus sich mit Sündern abgibt, sondern auch weil er mit ihnen Mahlgemeinschaft hält. Das ist eigentlich undenkbar für einen frommen Juden. Sie empören sich deshalb, weil es ihnen an Barmherzigkeit fehlt. Sie verstehen nicht, dass Jesus sich nicht deshalb mit ihnen abgibt, weil sie so gerecht sind, sondern weil sie reumütig und bereit zur Umkehr zu ihm kommen. Gott kommt dem Umkehrwilligen entgegen und hilft ihm dabei, das Leben ganz umzukrempeln. Doch die Pharisäer und Schriftgelehrten gönnen es diesen Menschen nicht. Vielleicht wären sie selbst gerne mit Jesus am Tisch und würden gerne über die Hl. Schriften diskutieren.
Und so setzt Jesus zu den Gleichnissen an, um sein Verhalten zu erklären: Wenn man hundert Schafe hat und eines geht verloren, dann wird man als guter Hirte die 99 zurücklassen, um das eine Schaf wiederzufinden. Man möchte, dass nicht ein einziges Schaf verloren geht. Jesus greift dieses erste Bild nicht umsonst auf. Er selbst ist der gute Hirte und bringt deshalb immer wieder das Bildfeld von Hirt und Herde an. Er wird alles tun, um auch den letzten Sünder zurück zur Herde zu führen. So ist Gott. Er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Er gibt ihm immer und immer wieder Chancen zur Umkehr, noch bis zum letzten Moment. Sein Wunsch ist es schließlich, dass er mit allen seinen geschaffenen Menschen im Himmel die ewige Liebesgemeinschaft haben kann. Das Bild des verlorenen Schafes ist ein Bild. Es weist über sich hinaus und ist unvollkommen. Denn Gott ist allmächtig. Er muss die anderen 99 Schafe nicht zurücklassen, sondern er kümmert sich um jedes einzelne Schaf so sehr, als wäre es das einzige. Wenn Gott einem verlorenen Schaf nachgeht, muss er die anderen Schafe nicht vernachlässigen. Doch Christus ist nun als Mensch unter Menschen. Er kümmert sich in dem Moment um die Sünder und Zöllner. Die zurückgelassenen Schafe sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gewissermaßen eifersüchtig reagieren.
Was wäre also die richtige Haltung der Zurückgelassenen? Sie sollten sich mit den Zöllnern und Sündern freuen, dass sie bereit sind, ihr Leben zu ändern. Sie sollten beten und mitfiebern, dass diese gekommenen Menschen wirklich zum Glauben kommen und nicht wieder weggehen. Sie sollten Jesus helfen, die verlorenen Schafe zurückzuholen. Sie sollten diese mit offenen Armen willkommen heißen und ihnen ein gutes Beispiel sein, damit sie davon motiviert wirklich am Ball bleiben. Letztendlich sind sie doch gemeinsame Söhne Israels, eine einzige Familie. Sie sitzen im selben Boot und tragen füreinander Verantwortung. Wo bleibt also die Solidarität zwischen den eigenen Stammesgenossen? Das ist auch der Grund, warum im Gleichnis der Hirte Freunde und Nachbarn ruft und feiert mit den Worten: „Freut euch mit mir!“ Er hat etwas Verlorenes wiedergefunden, das ihm sehr wertvoll war. So sollen die Pharisäer und Schriftgelehrten mitfeiern und sich für jene freuen, statt zu murren.
Jesus schließt daran weitere Gleichnisse an, die diese wichtige Botschaft beinhalten, das Gleichnis von der verlorenen Drachme und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gottes Liebe ist so groß, dass er für jeden einzelnen Menschen sämtliche Register zieht, sein Leben am Kreuz hingibt, sich bis auf das letzte Tröpfchen ausblutet und sein Herz für uns durchbohren lässt, für dich! Das ist die Botschaft dieses Hochfests. Lassen wir diese Botschaft ganz an unser Herz heran, lassen wir uns davon berühren und verwandeln, damit er unser Herz aus Stein herausreiße und sein heiligstes Herz einsetze, uns ganz nach seinem Wesen verwandle.
Ihre Magstrauss