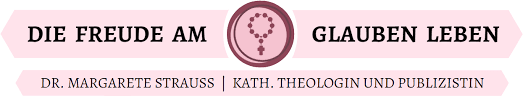1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-15.16-17; Lk 6,20-26
1 Kor 7
25 Was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat.
26 Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not, ja, es ist gut für den Menschen, so zu sein.
27 Bist du an eine Frau gebunden, suche dich nicht zu lösen; bist du ohne Frau, dann suche keine!
28 Heiratest du aber, so sündigst du nicht; und heiratet eine Jungfrau, sündigt auch sie nicht. Freilich werden solche Leute Bedrängnis erfahren in ihrem irdischen Dasein; ich aber möchte sie euch ersparen.
29 Denn ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine,
30 wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer,
31 wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt vergeht.
In der heutigen Lesung geht es um den Kontext der Endzeit, die man zur Zeit des Paulus als unmittelbar bevorstehend erwartete. Deshalb fragte man sich, wie man mit dem Thema Familiengründung, Ehe und Beziehungen angesichts des Weltendes umgehen sollte.
Paulus hat kein göttliches Gebot in dieser Frage, die die Korinther ihm offensichtlich in einem vorausgegangenen Brief gestellt haben. Deshalb beantwortet er ihre Frage mit einem persönlichen Ratschlag. Er sagt, dass angesichts des Weltendes es gut ist, in dem gegenwärtigen Lebensstand zu verharren, in dem man sich befindet, statt ihn zu ändern. Das heißt, dass die Unverheirateten unverheiratet bleiben sollen und wenn man verheiratet ist, sich nicht zu trennen. Es ist aber keine Sünde, wenn man sich nicht dran hält, denn wie oben beschrieben handelt es sich nicht um ein göttliches Gebot. Uns ist aus den Evangelien nicht bekannt, dass Jesus gesagt hätte: „Weil das Reich Gottes nahe ist, darf ab jetzt keiner mehr heiraten.“
Am Anfang des Kapitels hat Paulus auch erklärt, dass Ehepaare nicht zu einem zölibatären Leben verpflichtet sind, wie aber bestimmte Gruppen in der Gemeinde behaupteten. Dieser rigorose Umgang mit der Ehe würde früher oder später zur Unzucht führen. Deshalb sollen Paare sich einander auch nicht entziehen. Jesus hat auch nicht geboten, dass die Ehe aufgrund der Endzeit abgeschlossen sei. Paulus hält es dennoch für ratsam, nicht mehr zu heiraten, wenn am nächsten Tag vielleicht die Ewigkeit hereinbricht. Der Schlüsselsatz hier ist „die Zeit ist kurz“.
Warum aber erfahren Verheiratete Bedrängnis im irdischen Leben? Im weiteren Verlauf argumentiert Paulus damit, dass wer verheiratet ist, sich um die Dinge der Welt sorgen muss. Es ist eben keine geistliche Berufung und so ist man nicht ganz ungebunden für die Ewigkeit. Wer zölibatär lebt, ist in dieser Hinsicht freier. Das wird er auch an dieser Stelle mit „Bedrängnis“ gemeint haben. Er möchte diese aber den Christen ersparen, die nicht mehr viel Zeit haben. Das bedeutet aber nicht, dass es verboten ist, zu heiraten.
Er schlägt deshalb eine Haltung der Vorläufigkeit und des Gerüstetseins vor – es erinnert uns an die Worte des Mose an die Israeliten in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten: Wer eine Frau hat, soll so tun, als ob er keine habe. Wer weint oder sich freut, soll so tun, als ob er es nicht tue, wer einkauft, als ob er nichts kaufe. Diese Beispiele zählt er auf, um die Korinther aufzurufen zu einem Leben „mit einem Bein in der Ewigkeit“. Sie sollen sich bereit machen für das ewige Leben und somit geistlicher sein. Sie sollen keine großen Anschaffungen machen oder familiäre Beziehungen eingehen, die sie ganz vereinnahmen. Sie sollen die Traurigkeit des irdischen Lebens nicht an sich heranlassen, ebenso die Freuden der Weltlichkeit nur als vorläufig verstehen. Alles soll der Ewigkeit dienen und was sie davon abhält, sollen sie lieber lassen.
Deshalb fasst er es damit zusammen, dass man sich die Welt zunutze macht, aber nur in bedingtem Maße – denn die Welt ist vergänglich. Ehe ist vergänglich. Besitz und Emotionen sind vergänglich. Gott aber ist ewig. Das soll man zur Priorität machen. Wir haben eine Familie, die das ganz umgesetzt hat, worum es Paulus hier geht: die heilige Familie. Maria und Josef lebten zölibatär aus Berufung. Sie waren verheiratet und taten doch so, als ob sie es nicht wären. Sie hatten wenig Besitz und taten doch so, als ob sie ihn nicht hätten. Maria freute sich und weinte und doch behielt sie alles in ihrem Herzen mit dem Blick auf die Ewigkeit. Sie wusste, dass der Tod ihres Sohnes nicht das Ende war und behielt im Innersten die Gewissheit, dass die Auferstehung das Endziel sei. Sie ließ sich nicht zerreissen von vergänglichen Emotionen, sondern ließ sich erfüllen von der Freude des Hl. Geistes.
Ps 45
11 Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus!
12 Der König verlangt nach deiner Schönheit; er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder!
14 Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs, golddurchwirkt ist ihr Gewand und reich gemustert.
15 Sie wird in bunt gestickten Kleidern zum König geleitet, Jungfrauen sind ihr Gefolge, ihre Freundinnen werden dir zugeführt.
16 Sie werden geleitet mit Freude und Jubel, sie kommen in den Palast des Königs.
17 An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne; über das ganze Land setzt du sie ein als Fürsten.
Als Antwort auf die Lesung beten wir Psalm 45, einen Psalm zur Hochzeit des Königs. Ab Vers 11 wird die Frau selbst angesprochen: „Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus! Der König verlangt nach deiner Schönheit; er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder!“ Die Frau soll sich abnabeln, weil sie durch die Eheschließung ein Fleisch mit dem König werden soll. Zugleich soll er ihr Herr sein, sodass sie sich vor ihm niederwerfen soll. Maria hat Jesus nicht geheiratet und doch sind sie ein Menschenpaar, das nicht getrennt werden kann. Maria und Jesus sind geistlich so miteinander verbunden wie kein anderer Mensch mit Jesus verbunden sein kann. Sie ist zwar biologisch gesehen seine Mutter, aber sie ist auch seine Braut im mystischen Sinne. Sie ist der Archetyp der Kirche und macht es uns Christen vor, wie wir mit Christus vereint sein sollen als seine „Braut“. Das ist ja der springende Punkt der Argumentation Pauli. Er möchte den Menschen eine eventuelle „Zerrissenheit“ ersparen, indem sie neben ihrer geistigen Brautschaft mit Christus noch biologisch verheiratet sind. Das heißt aber nicht, dass er das von allen Menschen erwarten kann. Denn dies ist ja die Realität geistlicher Berufungen. Und zu so einem Leben ist ja nicht jeder berufen. Nicht jeder Mensch ist dafür gemacht.
Maria, deren Geburtstag wir morgen feiern, ist Christi erste und beste Jüngerin, die ihn Rabbi genannt haben wird und die seinen Worten stets mit ganz großer Offenheit und Gehorsam gelauscht hat. Sie hat alles umgesetzt, was ihr Sohn geboten hat. Darin ist sie wirklich Antitypos der Königsmutter Batseba. Sie war einerseits die Mutter des Königs, andererseits dessen Untertan. So ist sie für uns die Königsmutter, an die wir uns wenden können, denn sie sitzt ihm zur Rechten. Zugleich kommt sie ihm natürlich nicht gleich, sondern betet Christus an so wie wir. Sie ist Mensch, er ist Gott.
„Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs, golddurchwirkt ist ihr Gewand und reich gemustert.“ Es betrifft wörtlich gemeint zunächst ihr wirkliches Gewand, denn hier geht es um prachtvolle Hochzeitskleidung passend zum freudigen Anlass. Doch wir lesen diese Worte darüber hinaus im geistlichen Sinne und erkennen die Hochzeitsgewänder der Endzeit, von denen Christus auch gesprochen hat: Neulich hörten wir das Gleichnis von der Hochzeit des Königs und dem fehlenden Hochzeitsgewand bei einem Gast. Hier wird ein besonders prachtvolles Gewand geschildert und wenn wir es auf die „Tochter des Königs“ beziehen, sehen wir Marias wunderbar reines und prächtiges Gewand: ihre reine Seele, die so frei ist von der Korruption der Sünde. Ihre gerechten Taten voller Liebe, die Fülle der Gnade, die in ihr gewirkt hat.
Und mit ihrer Aufnahme in den Himmel, die wir vor einigen Wochen gefeiert haben, ist sie zu ihrem himmlischen König geleitet worden, begleitet von den himmlischen Heerscharen. Ihre bräutliche Gemeinschaft mit Gott ist archetypisch zu betrachten für die gesamte Kirche, aber auch für jeden einzelnen Getauften, wenn er im Stand der Gnade gestorben und vor Gott getreten ist. Die Hochzeit des wahren Königs, Christus, ist unser gemeinsames Ziel.
Ab Vers 16 wird das Brautpaar in seiner Verbindung betrachtet. Das Paar wird „geleitet mit Freude und Jubel“. Das ist die einzig angemessene Stimmung, denn das Menschenpaar der neuen Schöpfung, Jesus und Maria, hat der gefallenen Schöpfung eine Tür geöffnet. Christus hat die ganze Welt erlöst und Maria haben wir Christus zu verdanken. Durch beide ist die neue Schöpfung im Hl. Geist begründet worden. Der“ Palast des Königs“, in den beide einziehen, ist der himmlische Thronsaal, den die Propheten des Alten und Neuen Testaments geschaut haben. Maria ist so wie Jesus auch zum Vater gegangen und der Jubel durch die himmlischen Heerscharen ist groß!
„An die Stelle deiner Väter treten einst deine Söhne; über das ganze Land setzt du sie ein als Fürsten“ ist im Literalsinn zunächst auf die Nachkommen des Königs zu beziehen, dessen Hochzeit mit diesem Psalm ja gepriesen wird. Wir betrachten darüber hinaus die Nachkommenschaft des himmlischen Königs, die Familie Gottes, deren Kinder und Erben die Getauften sind. Als Erben im Reich Gottes werden sie Fürsten im ganzen Land sein. Wer auf Erden die Demut vollkommen gelebt hat, wird im Himmelreich auf Thronen sitzen. Wir haben wieder unsere himmlische Mutter vor Augen, die der Inbegriff der Demut ist. Ihr Leben hat uns vorbildhaft gezeigt, was wahre Demut ist. Und weil sie diese am meisten umgesetzt hat, ist ihr von allen Menschen die größte Ehre zuteilgeworden als Königin des Weltalls. Sie ist die Frau mit zwölf Sternen auf ihrem Haupt, die Frau, die über die zwölf Stämme des neuen Volkes Gottes herrscht. Und alle die Demütigen, die Armen im Geiste, sie werden das Himmelreich erben. Johannes sieht 24 Älteste auf Thronen um den Gottesthron herum. Dieses Bild bringt diese Herrschaft auf den Punkt.
Lk 6
20 Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.
21 Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.
22 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen.
23 Freut euch und jauchzt an jenem Tag; denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht.
24 Doch weh euch, ihr Reichen; denn ihr habt euren Trost schon empfangen.
25 Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und weinen.
26 Weh, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.
Was wir besonders im Psalm betrachtet haben, wird uns heute in den Seligpreisungen und Weherufen Jesu verdeutlicht. Ihre Botschaft ist: Jetzt schon sind jene selig zu preisen und können sich freuen, die Gottes Willen tun. Wer diesen aus Liebe befolgt, der hat jetzt schon den Himmel auf Erden, umso viel mehr in der Ewigkeit: „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“
Konkret ist dies der Fall für jene, die arm sind vor Gott. Damit ist nicht einfach nur der äußere finanzielle bzw. materielle Zustand des Menschen gemeint, sondern signalisiert eine innere Haltung von Armut, mit der man vor Gott dasteht: Wer also nicht an dem hängt, was er oder sie besitzt oder erreicht hat, auch Anhänglichkeit an Menschen, auch das Rühmen eigener Werke, der steht mit leeren Händen vor Gott wie ein Kind, das nichts weiter tun kann, als zu empfangen. Wie soll uns Gott auch beschenken, wenn wir meinen, schon alles zu haben? Das heißt nicht, dass wir keine Menschen lieben sollen, kein Geld haben dürfen oder keine Karriere anstreben sollen – aber wir sollen nicht daran hängen. All das soll uns dazu dienen, dem Reich Gottes näher zu kommen – und wenn nicht, sollen wir es von uns abschneiden. Und wenn man viel besitzt, ist die Aufgabe, nicht daran zu hängen, gewiss schwerer. So können wir schauen, wo wir in unserem Leben Abstriche machen können. Zur christlichen Askese (nicht nur für Geistliche!) gehört immer die Frage: „Brauche ich das wirklich?“ So viel zu haben, wie notwendig, aber nicht darüber hinaus – das ist der richtige Rahmen, diese innere Losgelöstheit von irdischen Gütern zu gewährleisten. Und dennoch ganz politisch inkorrekt: Ein reicher Mensch kann arm vor Gott sein und ein armer Mensch kann noch mehr an seinen Gütern hängen und somit ein Reicher vor Gott sein als jener, der viel besitzt.
Der Hunger, von dem hier die Rede ist, meint nicht nur den körperlichen Hunger, sondern auch die seelische Sehnsucht und auch die Sehnsucht nach der Gerechtigkeit. Wie sehr wünschen auch wir uns die Gerechtigkeit Gottes – sie ist etwas Erlösendes, nicht etwas Bedrohliches. In diesem Sinne sättigt sie uns und in diesem Sinne wird das Gericht Gottes am Ende der Zeit verbunden mit dem endzeitlichen Festmahl kommen, bei dem wir „fette Speisen“ genießen werden (Jes 25,6). Und wir werden auf dem Weg in die Ewigkeit genährt durch die Sakramente, vor allem durch die Himmelsspeise, die die Eucharistie für uns bedeutet.
Wer in diesem Leben traurig ist und weint – und das meint nicht nur die Trauer um einen lieben Menschen, sondern auch die Trauer um die Gottlosigkeit der Gesellschaft, den Tod des Glaubens in der Welt, wird getröstet werden mit dem lebendigen Glauben in den Oasen unserer heutigen geistigen Wüste, umso vollkommener im Himmelreich. Und wer um einen Verstorbenen trauert, wird getröstet werden durch die Botschaft von Ostern. Der Tod ist nur vorübergehend und die Hoffnung ist lebendig, dass es in der Ewigkeit ein Wiedersehen gibt. Traurigkeit kommt nicht von Gott, sondern die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das Himmelreich wird deshalb so oft mit dem Bild der Hochzeit des Lammes umschrieben.
Und wenn wir verfolgt werden im Namen Gottes, dann seien wir gewiss: Das Himmelreich ist uns sicher. Nicht umsonst glauben wir, dass die Märtyrer sofort zum Herrn kommen. Johannes sieht sie als Siegesschar in der Offenbarung und in der Ikonographie werden die Märtyrer mit Siegessymbolen wie dem Palmzweig dargestellt. Den Verfolgten, die ihr Leben für Gott hingeben, ist das Himmelreich wirklich sicher.
Es muss aber nicht so weit kommen, dass wir für unseren Glauben an Jesus Christus umgebracht werden: Schon die Nachstellungen, Beschimpfungen, blöden Kommentare, gesellschaftlichen Nachteile – all dies sieht Gott und wird entsprechend belohnen, viel besser noch: entschädigen. Schon die Propheten haben das erlebt, umso wie viel mehr trifft es die Christen! Elija hat einiges durchgemacht so wie die anderen Propheten, die man sogar umgebracht hat. Und Jesus hat das Leiden der Jüngerschaft ganz klar angekündigt. Und doch dürfen wir uns geborgen wissen. Wenn uns auch die äußeren Stürme zerreißen wollen: Unseren Glauben kann uns niemand nehmen, ebenso wenig unser ewiges Leben.
Jesus schließt an die Makarismen nun Weherufe an: Das Wehe ist an die Reichen gerichtet, die schon ihren Lohn empfangen haben. Sie haben den irdischen und damit unvollkommenen, zeitlich begrenzten Lohn empfangen. Sie treten mit vollen Händen vor Gott. Wie soll er ihnen das ewige Leben geben? Die jetzt lachen, werden weinen. Einerseits sind jene zu betrachten, die über die Jünger Jesu lachen, die Gott verlachen und seine Gebote nicht ernst nehmen. Es sind auch jene, die diese Welt voller Freude annehmen und sich an der gefallenen Schöpfung ergötzen, die voll im Weltrausch die Hochzeit jetzt schon feiern, doch ohne den echten Bräutigam…sie werden weinen, weil sie auf ewig ihre Entscheidung bereuen werden und nicht mitfeiern dürfen bei der Hochzeit des Lammes. Die, die jetzt satt sind, weil sie sich mästen mit der Weltlichkeit und Vergänglichkeit des irdischen Daseins, werden hungern am Ende der Zeiten. Sie werden nämlich ohne die Gnade Gottes die Ewigkeit durchleben müssen. Diese ist es aber, die den Menschen wirklich auf Dauer nährt. Die fetten Speisen gibt es bei der Hochzeit des Lammes, nicht beim Rausch der Weltgelage.
Wer auf Erden von allen gelobt wird, wird am Ende das Gegenteil erfahren. Es geht nicht um ein Lob für eine gute Tat, sonst müssten wir jedesmal Sorge haben, nicht ins Himmelreich zu kommen! Es meint, dass man so weltlich eingestellt ist und den Menschen gefällt, weil man selbst so wie bei den Vätern zum falschen Prophet geworden ist. Es meint auch jene, die das Lob anderer Menschen suchen und der Gefallsucht anheimgefallen sind. Wer dagegen im Namen Jesu Christi auftritt, wird zumeist weniger positives Feedback erhalten. Und wenn doch, soll es nicht bei einem selbst bleiben, sondern wir sollen das Lob an Gott weiterleiten, dem es gebührt. Was wir gut gemacht haben, verdanken wir schließlich ihm. Lob anzunehmen, ist also nicht per se eine Sünde, sondern sogar Ausdruck wahrer Demut: „Danke, alles zur größeren Ehre Gottes!“ Unsere liebe Mutter Maria ist darin das beste Vorbild. Ob die Menschen sie gelobt oder getadelt haben – das hat ihr nie so etwas bedeutet wie die innige Gemeinschaft mit Gott.
Ihre Magstrauss