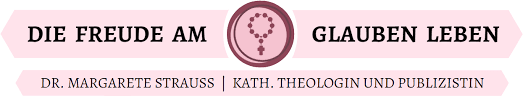1 Tim 1,1-2.12-14; Ps 16,1-2 u. 5.7-8.9 u. 11; Lk 6,39-42
1 Tim 1
1 Paulus, Apostel Christi Jesu gemäß dem Auftrag Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung,
2 an Timotheus, sein rechtmäßiges Kind im Glauben. Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn.
12 Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat: Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen,
13 obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat.
14 Doch über alle Maßen groß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte.
Heute beginnt die Bahnlesung aus dem ersten Timotheusbrief. Es handelt sich um einen der drei Pastoralbriefe, die deshalb so genannt werden, weil sie sich an pastorale Mitarbeiter des Paulus richten. Die Situation des Briefes ist Folgende: Paulus war in Ephesus zusammen mit Timotheus. Als er weiter nach Mazedonien zog, blieb sein Begleiter in Ephesus zurück. Er soll die Gemeinde weiter betreuen, ja ihr erster Bischof werden und vor allem die richtigen Weihekandidaten wählen. Deshalb zählt Paulus die entscheidenden Kriterien für Weihebewerber auf.
Heute hören wir zunächst das Präskript mit Sender und Empfänger sowie einen Gruß.
Paulus nennt sich „Apostel Christi Jesu gemäß dem Auftrag Gottes…“. Was er in dem Brief an Timotheus schreibt, trägt er also in seiner apostolischen Autorität zusammen, die direkt von Gott kommt.
Timotheus wird als Empfänger angegeben, wobei Paulus ihn sein „rechtmäßiges Kind im Glauben“ nennt. Er versteht sich als geistiger Vater des Mannes.
Daraufhin erfolgt ein Gruß, der die beiden typisch paulinischen Begriffe von Gnade und Friede aufgreift, jedoch noch durch Erbarmen ergänzt wird.
Als nächstes hören wir einige Verse eines Danklieds des Paulus: Er dankt Christus für die Kraft, die dieser ihm verleiht, und das Erbarmen, das er von ihm empfängt. Dass Christus ihm überhaupt so eine Sendung überträgt, obwohl er früher ein Christenverfolger war, zeugt von Gottes unendlicher Güte. Er erklärt, dass ihm die Barmherzigkeit Gottes zuteilgeworden war, weil er nicht wusste, was er tat.
Beten wir also viel öfter für unsere Missetäter und all die Menschen, die heutzutage Gott beleidigen. Oft wissen auch diese Menschen nicht, was sie tun. Dann müssen auch wir ihnen helfen, dass sie die Gnade einer tiefen Umkehr erhalten, auch wenn wir von ihnen Unrecht erfahren haben.
Gottes Gnade ist übermäßig groß. Er hat einen Christenverfolger zu einem Völkerapostel gemacht. Er kann auch heutzutage aus einem Atheisten einen brennenden Christen machen. Er kann auch uns verwandeln, wir müssen nur unser Ja geben.
Ps 16
1 Ein Lied Davids. Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen!
2 Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein.
5 Der HERR ist mein Erbanteil, er reicht mir den Becher, du bist es, der mein Los hält.
7 Ich preise den HERRN, der mir Rat gibt, auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt.
8 Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht.
9 Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre, auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit.
11 Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. Freude in Fülle vor deinem Angesicht, Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit.
Als Antwort beten wir einen vertrauensvollen Psalm, was uns durch „denn bei dir habe ich mich geborgen“ gleich am Anfang deutlich wird. Es ist ein Gebet, das Paulus und Timotheus beten können in der Situation einer neuen Gemeinde und einer neuen Aufgabe für Timotheus. Paulus ist ganz getragen von der wunderbaren Vorsehung Gottes. Er hat es an seiner eigenen Bekehrungsgeschichte betrachtet.
Gott allein ist unser ganzes Glück, weil alles Andere uns nie vollends beglücken kann. Verlassen wir uns ganz auf Menschen, werden wir früher oder später enttäuscht werden. Gott ist der wirklich immer Treue, der seine Versprechen immer hält, der immer für uns da ist. Er hat keine Grenzen der Liebe wie der Mensch. Seine Liebe ist eine reine Liebe ohne Eigennutz und Selbstsucht. Die Liebe des Menschen ist vielfach korrumpiert.
Gott schenkt Freude. Das wird durch das Bild des Bechers ausgedrückt. Der Psalmist drückt sein Vertrauen auf Gott aus, das er die ganze Zeit nicht verloren hat. Der Psalm ist von König David, von dem wir sehr viele Situationen kennenlernen. So oft stand sein Leben auf der Kippe, doch weil er sich dann ganz an Gott geklammert hat, hat dieser ihn auch aus den Nöten herausgeführt.
Auch Christus hat ein solches Vertrauensverhältnis zum Vater gezeigt. Er, dessen Leben komplett auf der Kippe stand, dessen Leben wie das eines Verbrechers weggeworfen wurde!
Jesus hat bis zum letzten Atemzug dieses Vertrauen auf den Vater aufrechterhalten. Dieser war bis zum Schluss sein „ganzes Glück“.
Gott ist Davids Erbanteil – er versteht, dass die ganze Verheißung des Landes und eines Lebens in Fülle von Gott kommt. Er ist es, der Freude schenken kann und das Los jedes Menschen in Händen hält. Und eben dies hat Christus intensiviert auf einem Niveau, an das kein Mensch heranreicht. Die Freude, die er auch noch am Kreuz nicht verliert (es meint keine Emotion, sondern eine tiefe Gewissheit, dass am Ende alles gut wird), ist ein absolutes Vorbild für alle Leidenden. Der Vater hat ihm den Becher gereicht – nach dem bitteren Kelch kam der Freudenwein, der bis heute gefüllt wird in jeder Heiligen Messe! Damit verbunden ist der Erbanteil für das Reich Gottes, der jedem getauften Christen zugeteilt wird. Der Wein wird auf vollkommene Weise ausgegossen am Ende der Zeiten, wenn die Hochzeit des Lammes kommt. Dann wird eine ewige Freude sein, die nie mehr enden wird! Dann wird der Wein niemals ausgehen wie bei der Hochzeit zu Kana.
Gott ist es auch, der dem Menschen Rat gibt. Er tut es durch das Innere des Menschen. Wir sagen heute durch das Gewissen. Der Herr gibt es dem Menschen ins Herz, was er tun soll. Deshalb ist es wichtig, ein reines Herz zu behalten, stets im Stand der Gnade zu sein und ein geschärftes Gewissen zu haben (der Garant dafür ist das Sakrament der Versöhnung!). König David hat es selbst in den Nächten seines Lebens erfahren, das heißt vor allem im moralischen Sinne. Wenn er sich gegen Gott versündigt hat und die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommen hat, hat er sich dennoch nicht aufgegeben und sich noch mehr an den Herrn geklammert. Dieser hat ihn von der Nacht wieder in den Tag geführt.
Und von Jesus wissen wir von der tiefsten Nacht. Diese hat er am Kreuz verspürt, auch wenn es keine moralische Nacht ist. Er ist selbst zur Sünde geworden, gemeint ist das Kreuz, doch selbst hat er nie gesündigt. Er ist in die Nacht des Todes hinabgestiegen, um am Ostermorgen mit dem Sonnenaufgang von den Toten aufzustehen!
David hat den HERRN beständig vor Augen, dieser ist zu seiner Rechten. Diese Worte weisen über ihn hinaus auf den Messias, der nun wirklich nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt den Vater beständig vor Augen hat! Er ist zu seiner Rechten, wie wir im Glaubensbekenntnis beten.
Jesus ist der erste der neuen Schöpfung, der sich freuen kann, ewig beim Herrn zu sein. Ihm werden wir es gleichtun, wenn wir bis zum Schluss standhaft geblieben sind und von Gott heimgeholt werden in die himmlische Heimat. Dann wird auch unser Herz sich ewig freuen. Und am Ende der Zeiten wird auch mein und unser Fleisch in Sicherheit wohnen, wenn die Seele sich mit ihm wieder vereinen wird. Dann werden wir mit unserem ganzen Dasein bei Gott sein so wie Jesus und auch Maria.
Und dabei hat Gott durch die Propheten des Alten Testaments und schließlich durch seinen eigenen Sohn den „Weg des Lebens“ aufgezeigt – die Lebensweise, die ein Leben nach dem Tod ermöglicht. Dieser Weg des Lebens ist es, den Paulus auf der ganzen Welt verkündigt und den er auch Timotheus ans Herz legt. Dieser Weg führt geradewegs in die himmlische Freude vor Gottes Angesicht.
Lk 6
39 Er sprach aber auch in Gleichnissen zu ihnen: Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen?
40 Ein Jünger steht nicht über dem Meister; jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein.
41 Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?
42 Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen!, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.
Im Evangelium sehen wir nun die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Frömmigkeit. Im Grunde kann man sagen: Wir sehen hier eine Negativfolie des Paulus. Hier geht es um jene religiösen Leitungsfiguren, die eben nicht auf ihr eigenes Gewissen bedacht sind, nicht zuerst selbst umkehren, sondern heuchlerisch von den anderen fordern.
Jesus bringt das Bild von Blinden an: Ein Blinder kann einen anderen Blinden ja nicht führen, denn beide fallen dann früher oder später in eine Grube hinein. Er kritisiert vor allem die religiöse Elite seiner Zeit, denn bei ihnen hat sich die Haltung entwickelt, sich selbst als unantastbar zu verstehen, nicht umkehrbedürftig und schon vollkommen. Sie leben in der Illusion, dass nur das einfache Volk kritisierbar sei. Sie suchen noch die kleinsten Unvollkommenheiten bei den ihnen Anvertrauten, dass sie komplett vergessen, ihr eigenes Gewissen zu bereinigen, das von schweren Sünden belastet ist.
Jesus nennt sie unverblümt Heuchler. Denn sie sehen den Splitter im Auge des Bruders, aber nicht ihren eigenen Balken. Da fragt man sich: Wie können sie überhaupt etwas sehen mit so einem dicken Stück Holz im Auge! Bevor jene, die religiöse Verantwortung übernehmen, also die anderen ermahnen können, müssen sie zuerst an sich selbst arbeiten. Zuerst müssen sie ihren eigenen Balken aus dem Auge ziehen, ihre Sünden bereuen und umkehren, bevor sie anfangen können, sich der Sünden der ihnen anvertrauten Schafe zu widmen.
Was Jesus uns sagt, heißt nicht, dass wir nur dann kritisieren oder erziehen dürfen, wenn wir perfekt sind. Aber die großen Balken sollten wir vielleicht doch erst einmal herausziehen. Seine Worte sind höchst aktuell. Auch bei uns muss es immer so sein, dass je größer die Verantwortung ist (im Kontext von Erziehung und Bildung, von Seelsorge und Politik), desto größer die eigene Gewissenserforschung sein muss. Ein Geistlicher muss eigentlich viel häufiger beichten als ein nichtgeweihter Gläubiger. Ein Bischof muss in dieser Hinsicht noch viel strenger auf sich achten als ein einfacher Pfarrer. Je mehr Seelen man betreut, desto weißer muss die Weste sein. Und je mehr Verantwortung man erhält, desto bewusster muss einem die eigene Armseligkeit sein. Ich wiederhole Jesu Worte im Abendmahlssaal: Wer herrschen will, muss der Diener aller sein. Je höher der Sitz, desto niedriger der Blick. Das Stichwort ist Demut. Wir haben von Paulus gehört, wie das aussehen muss. Er selbst steht zu seiner Vergangenheit und vergisst das auch nie, um Gottes großes Erbarmen preisen zu können.
Und vor allem: Wer nicht in absoluter Sehnsucht nach Gott verkündet und Seelsorge betreibt, wird die Menschen nicht von Gott begeistern können. Paulus‘ Herz brannte vom Evangelium Jesu Christi. König David hat mit einer Gottessehnsucht die Psalmen komponiert, dass wir zusammen mit ihm in diesen sehnsüchtigen Gesang einstimmen können. Der Heilige Augustinus hat gesagt: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ Das ist der springende Punkt. Und der Balken im Auge ist gewiss kein Brennholz…
Ihre Magstrauss