Hebr 5, 1-10; Ps 110 (109), 1-2.3.4-5; Mk 2, 18-22
Hebr 5
1 Denn jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen.
2 Er ist fähig, mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit,
3 und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Sündopfer darbringen.
4 Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron.
5 So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt,
6 wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.
7 Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht.
8 Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt;
9 zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden
10 und wurde von Gott angeredet als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks.
In der heutigen Lesung betrachten wir wieder die hohepriesterliche Eigenschaft Jesu Christi. Es ist schon zuvor angeklungen, dass er mit den Menschen mitfühlt, weil er selbst alles durchgemacht hat. Er ist den Menschen in allem gleich außer der Sünde. Dieses Gleichsein ist dadurch ermöglicht worden, dass er sich entäußert hat, um den Menschen gleich zu werden. Was bedeutet das? Das griechische Wort ist die kenosis. Gott hat die „Schwachheit des Fleisches“ freiwillig angenommen, das heißt die Begrenztheit und Zerbrechlichkeit der ersten Schöpfung, und hat seine Gottheit nicht in Anspruch genommen. Durch diesen freiwilligen Verzicht ist er wahrlich einem Hohepriester ähnlich geworden. So wie dieser von Gott berufen wird, ist Christus vom Vater berufen worden. Hier wird die Offenbarung der Sohnschaft Christi bei der Taufe angedeutet vor dem Hintergrund alttestamentlicher Verheißungen („heute habe ich dich gezeugt“, Ps 110). So wie der Hohepriester für das Volk und für sich selbst bittet, so hat Christus „unter Schreien und Tränen“ Gebete und Bitten vorgebracht. Er musst für sich selbst aber kein Opfer darbringen, weil er ohne Sünde ist und somit keine Sühne braucht. Das macht den großen Unterschied. Eine weitere Sache unterscheidet ihn von Aaron, der hier zum Vergleich herangezogen wird: Christus ist nicht Hohepriester des aaronitischen Zweigs wie die gesamte Kultfamilie Israels, sondern er ist Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Dabei handelt es sich um eine gleichsam mysteriöse Gestalt, dessen Ursprung und Identität nicht offengelegt werden. Er begegnet Abraham, er bringt Brot und Wein dar und das Entscheidende: Er segnet Abraham. Das bedeutet, er steht über Abraham, von dem Mose und Aaron abstammen werden und mit ihnen der ganze priesterliche Stamm. Christus steht über allen Hohepriestern des Alten Bundes. Auch wenn Christus höher steht als diese alle, ja der Sohn Gottes höchstpersönlich ist, ist er nicht vom Leiden verschont geblieben. Das müssen wir genauer betrachten: Er hat die Schwachheit der Menschen angenommen, was auch das Leiden einbezieht. Die Folgen der Erbsünde sind das Leiden und der Tod. Auch wenn er von der Erbsünde verschont geblieben ist, wird er in die weitreichenden Konsequenzen hineingezogen, die die ganze Welt betreffen. Das ist es, was mit „Fleisch“ gemeint ist – die gefallene Schöpfung, die alles betrifft, auch die Nahrungskette der Tiere, das entstandene Chaos der Naturgewalten, einfach alles. Die Schöpfung lehnt sich gegen die Sünde des Menschen auf. Gott hat seinen Sohn also nicht verschont, als er ihn zur ultimativen Hohepriesterschaft beruft. Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. So werden sie beide zum Antitypos der Beziehung Abraham-Isaak. Auch Abraham soll seinen Sohn opfern, doch es ist eine Prüfung. Kurz bevor er seine Tat vollziehen kann, gebietet ihm ein Engel, seinen Sohn nicht zu opfern. Im Gegensatz zu diesen beiden verschont der himmlische Vater seinen Sohn nicht. Auch in seinem Fall ist der Sohn das Kostbarste, was er hat. Und doch ist er bereit, diesen Schatz für uns hinzugeben! Danken wir ihm dafür.
Ps 110
1 Ein Psalm Davids. So spricht der HERR zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten und ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße.
2 Das Zepter deiner Macht streckt der HERR aus vom Zion her: Herrsche inmitten deiner Feinde!
3 Dich umgibt Herrschaft am Tag deiner Macht, im Glanz des Heiligtums. Ich habe dich aus dem Schoß gezeugt vor dem Morgenstern.
4 Der HERR hat geschworen und nie wird es ihn reuen: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.
5 Der HERR steht dir zur Rechten; er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Heute beten wir als Antwort auf die Lesung Ps 110, einen Königspsalm, der so viele messianische Andeutungen besitzt, dass er den am häufigsten zitierten alttestamentlichen Text im Neuen Testament darstellt.
Gott spricht: „Setze dich mir zur Rechten“, was uns an Jesus Christus erinnert, den wir zur Rechten des Vaters glauben. Er ist aufgefahren in den Himmel, um nun an der Seite des Vaters zu sein. So beten wir im Glaubensbekenntnis. Doch zunächst auf König David angewandt bedeutet dies, dass wenn König David in Gemeinschaft mit Gott ist, gesegnet sein wird. Zur Rechten Gottes zu sitzen, meint im wörtlichen Sinn also zunächst, ganz in Gott zu sein, wir würden sagen: im Stand der Gnade zu sein. Es ist also moralisch zu verstehen und darin können wir uns mit König David identifizieren. Wenn wir also ganz in Gemeinschaft mit Gott sind, liegt auch auf unseren Plänen und Vorhaben, auf unseren Bemühungen und Bestrebungen Gottes Segen. Wenn dann verheißen wird, dass Gott seine Feinde wird unter den Schemel seiner Füße stellen wird, ist es im Falle Davids auf die Kriegserfolge zu beziehen. Wenn er ganz in Gott bleibt, um es einmal johanneisch auszudrücken, dann wird er seine Feinde besiegen und ein Friedensreich schaffen. Das ist es, was der Herr den Propheten eingibt, die den Messias ankündigen. Sie erwarten einen neuen David, einen Nachkommen, dessen Reich Bestand haben wird und das vor allem ein Friedensreich sein wird. Wenn wir diese Stelle nun christologisch verstehen, sehen wir die Feinde Christi vor uns: Bezogen auf sein erstes Kommen und seine Erlösungstat denken wir an den Tod, den er besiegt, indem er von den Toten aufersteht! Wir sehen auch die Sünde der Welt, die er ein für allemal gesühnt hat. Das sind Abstracta, die aber auf einen ganz konkreten Feind zurückzuführen sind: den Widersacher Gottes, den Satan. Dieser ist der Feind Christi. Betrachten wir die momentane Phase in der Heilsgeschichte, sehen wir den bleibenden Spielraum des Bösen bis zum Ende der Zeiten. Dann aber wird der Vater ihn endgültig unter die Füße Christi treiben. Dann wird ganz mit ihm abgerechnet. Selbst der Tod wird zerstört werden.
Die Wiederkunft Christi wird angedeutet durch sein Erscheinen in heiligem Schmuck. Und dennoch ist diese Aussage mehrfach zu verstehen: Allein auf König David bezogen ist sie in ihrer Tiefe nicht zu begreifen, denn warum ist er von Gott gezeugt worden und nicht von Isai? Und warum ist er vor dem Morgenstern gezeugt worden? Wir begreifen diese Aussage immerhin als Gewolltsein von Gott, als die Zusage, dass Gott ihn ins Dasein gerufen hat wie jeden Menschen, mit einem eigenen Plan, mit einer eigenen Berufung. Und doch weist die Aussage über sich selbst hinaus auf Christus, der wirklich wortwörtlich vor dem Morgenstern gezeugt wurde. Er ist kein Geschöpf, er ist nicht geschaffen, sondern gezeugt. Er ist zudem, bevor überhaupt etwas geschaffen worden ist. Der „Tau in der Frühe“ ist zutiefst messianisch. Nicht umsonst singt die Kirche in der Adventszeit „Tauet Himmel den Gerechten, Wolken, regnet ihn herab“. Das Kommen des Messias wird wie das Herabregnen des Niederschlags verstanden. Und was ist der heilige Schmuck Christi? Es ist moralisch zu verstehen als seine Sündenlosigkeit, es ist aber auch anagogisch zu verstehen als seine Herrlichkeit, die er offenbaren wird am Ende der Zeiten, wenn er nämlich zum zweiten Mal kommt! Dann wird diese Entäußerung, von der noch in der Lesung die Rede ist, nicht mehr sein.
Und dann sagt Gott selbst ihm zu, dass er Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Das ist nun wirklich über König David hinaus zu verstehen. Christus ist nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester. Er steht über dem gesamten Kult des Alten Bundes. Sein Opfer ist endgültig, weshalb es die Opfer des Alten Israel nicht mehr braucht. Und diese Ordnung auf Christus bezogen ist eine ewige Ordnung. „Nie wird es ihn reuen“ müssen wir als Anthropomorphismus verstehen, der hier in einem poetischen Kontext formuliert wird, das heißt eine Wesensart des Menschen, die auf Gott angewandt wird: Gott ist kein Sünder. Er muss nichts bereuen, aber so hat man Gott gedacht, so wird er vor allem in den ältesten Schriften des Alten Testaments gedacht. So lesen wir davon, dass er die Sintflut bereut. Gott ist weder impulsiv noch begeht er Fehler. Er ist der Vollkommene und Heilige. Er muss nichts bereuen, sondern so stellt König David sich Gott vor bzw. kann es auch sein, dass er begreift, dass Gott nichts bereuen muss, aber er verwendet es bildlich, weil er hier ja im Psalm dichtet.
Der Herr zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Dieser Tag umschreibt den Jüngsten Tag, an dem Christus als verherrlichter Menschensohn wiederkommt. Dann wird er mit den Mächtigen dieser Welt abrechnen. Dann wird allen offenbar werden, wer der wahre Herrscher ist. Das ist für uns eine tröstliche Botschaft, weil es uns zeigt: Gott hat das letzte Wort. Er ist der Herr der Geschichte und entgegen aller gegenwärtigen Eindrücke wird er am Ende seinen Heilsplan durchsetzen.
Mk 2
18 Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten?
19 Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten.
20 Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein; dann werden sie fasten, an jenem Tag.
21 Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand; denn der neue Stoff reißt vom alten Gewand ab und es entsteht ein noch größerer Riss.
22 Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche; der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört in neue Schläuche.
Im heutigen Evangelium dreht sich alles darum, wo wir heilsgeschichtlich stehen. Damit verbunden steht auch die Frage im Raum, wer Jesus ist.
Der Streitpunkt ist dabei das Fasten, eine Sache, die man nach außen hin zur Schau stellen kann und die vor allem eine Vorbereitung auf das Kommen der messianischen Heilszeit darstellt.
Die Johannesjünger und die Pharisäer fasten zusätzlich zu den gebotenen Fastentagen für die Juden. Bei den Johannesjüngern geht es dabei um die Buße für den kommenden Messias. Das ist ihre Berufung. Die Pharisäer sühnen ursprünglich für das Volk, aber leider sind sie versucht, dies den anderen vorzuhalten oder sich höher zu stellen als der Rest. Sie verkennen dabei, dass nicht der Unterschied in der Fastenpraxis sie vor Gott gerechter machen kann als die anderen. Die eigene Reue und Umkehr, das Tun des Willens Gottes, der Gehorsam macht Gerecht vor Gott.
Jesus ist der Messias. Er muss nicht wie die Johannesjünger fasten, weil er ja das Ziel ihrer Vorbereitung ist. Er ist der Bräutigam, der um seine Braut Israel wirbt. Jetzt ist der Bräutigam da und er möchte durch seine Feiermentalität herausstellen, wer er ist. Im gesamten AT lesen wir diese Metapher der Braut Israel und des Bräutigams Gott. Dieser greift die Hauptmetapher der heiligen Schrift auf, die die Juden eigentlich erkennen sollten. Nun ist er so weit gegangen, Mensch zu werden, um ganz bei seiner Braut zu sein. Kann man da fasten? Natürlich nicht! Diejenigen, die sich an Jesu fehlendem Fasten stören, haben ihn als Messias nicht erkannt. Sie erkennen nicht, dass die Vorbereitungszeit vor dem Kommen des Messias schon abgeschlossen ist, weil die neue, messianische Heilszeit angebrochen ist!
Jesus deutet auch an, dass er sterben werde, weshalb der Bräutigam der Braut weggenommen werde. Für alles gibt es eine Zeit, so das Buch Kohelet. Jetzt ist die Zeit zum Feiern und mit Jesu Tod kommt das Fasten.
Ab Vers 21 versucht Jesus durch zwei Bilder die ganz neu angebrochene Epoche zu verdeutlichen. Mann kann keine zwei unterschiedlichen Stoffe aufeinandernähen, weil sie sonst reißen. Man kann keinen neuen Wein in alte Schläuche gießen, weil diese zerbersten. Was Jesus durch die Bilder konkret sagen möchte: Ihr könnt nicht bei der angebrochenen messianischen Heilszeit weiterhin so tun, als sei sie noch nicht da. Ihr könnt nicht jetzt, wo ich direkt vor euch stehe, weiterhin auf den Messias warten. Dann fährt der Zug ohne euch ab. Mit dem gekommenen Messias müsst ihr eine vollkommen neue Verhaltensweise an den Tag legen.
Auch für uns sind das zwei wichtige Bilder, die an uns appellieren: Wir können nicht Jesus nachfolgen und dabei noch ein bisschen an dem alten sündigen Leben hängen. Wenn wir als Neugetaufte in die Gemeinschaft der Kirche eingegliedert worden sind, sind wir neugeboren im Heiligen Geist. Dann können wir nicht mehr so leben, als wären wir nicht getauft. Wenn wir gebeichtet haben und zurück in den Stand der Gnade gekommen sind, können wir nicht die alten sündhaften Verhaltensweisen fortsetzen. Wir haben in der Beichte Jesus versprochen, uns zu ändern. Wenn wir trotzdem das alte Leben weiterführen, wird ein großer Schaden entstehen wie die zerbersteten Schläuche und der größere Riss im Stoff. Jetzt wo wir die Gnade der Vergebung erhalten haben und vor allem zur Erkenntnis unserer Sünde gelangt sind, werden wir viel größere Verantwortung für dieselben Vergehen tragen müssen. Jetzt tun wir die bösen Dinge ja, obwohl wir ihre Bosheit erkannt haben.
Der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks hat uns durch sein endgültiges Opfer vor Gott gerecht gemacht. Wie können wir nun so tun, als sei diese Sühnung nie geschehen!
Wir erfahren nicht davon, wie die Fragesteller reagiert haben, aber es wäre schon interessant, ob der ein oder andere Jesu Worte verstanden hat und ihm nachgefolgt ist.
Gott hat in seinem Heilsplan den Höhepunkt erreicht. Er hat seinen einzigen Sohn dem auserwählten Volk an die Seite gestellt. Und auch hier ist es nicht ge-hor-sam – es hört nicht zu, was Gott ihm erklärt. Stattdessen will es die eigenen Dinge tun, um vor Gott gerecht zu werden (also lieber fasten, obwohl Gott ihnen in dieser Zeit signalisiert: „Jetzt nicht, meine Kinder! Ich bin gekommen, also lasst uns feiern!“). Die Selbstgerechten verpassen die Chance, die Gott ihnen bietet. Wir Menschen sind alle erlösungsbedürftig. Keiner von uns kann sagen: Ich brauche die Erlösung nicht. Je schneller wir das begreifen und uns Gottes Wirken nicht mehr entziehen, desto heilsamer ist es für uns!
Ihre Magstrauss
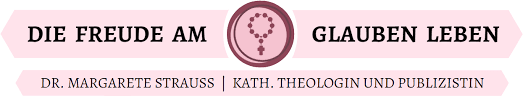
Ein Kommentar zu „Montag der 2. Woche im Jahreskreis“